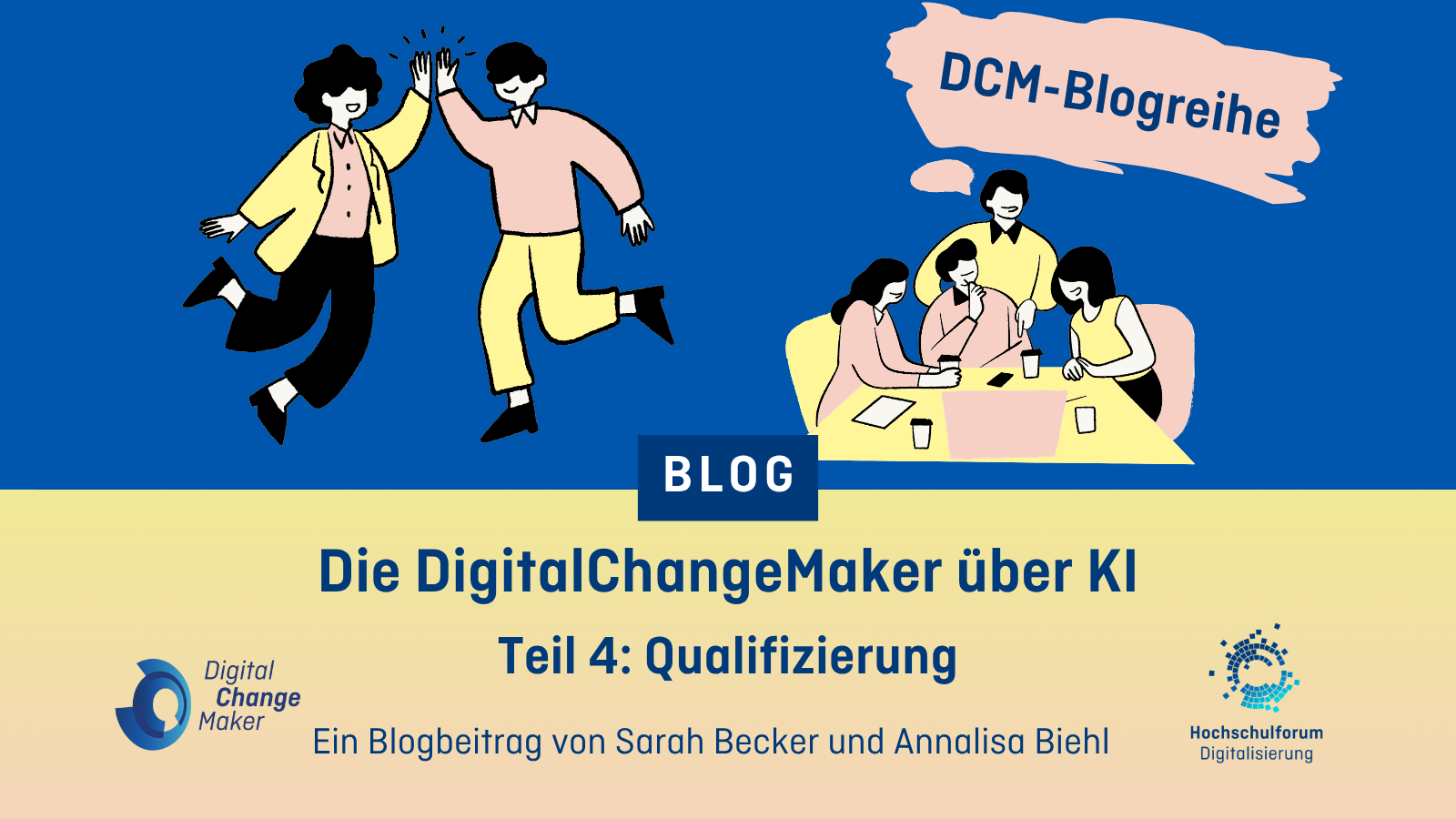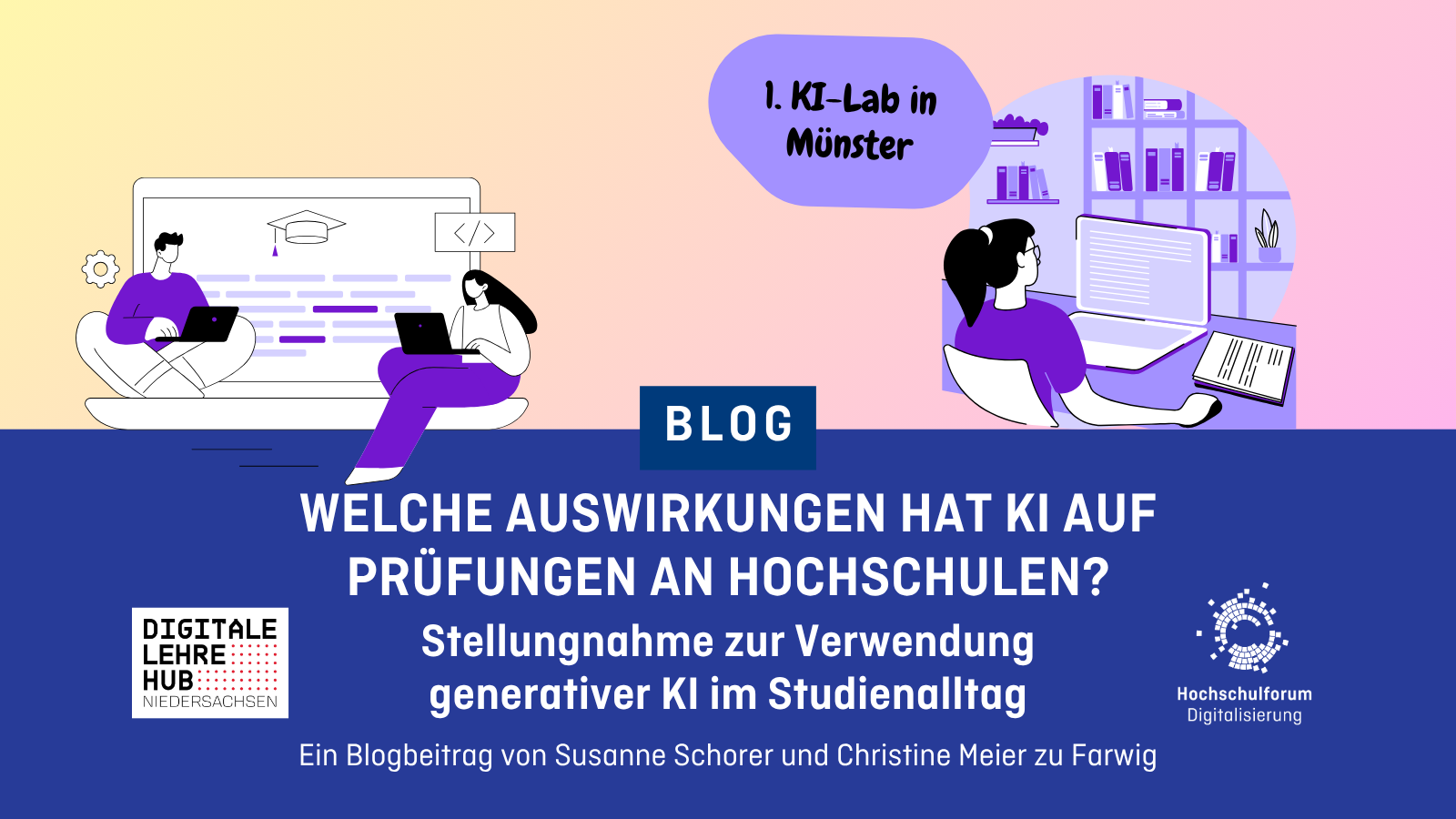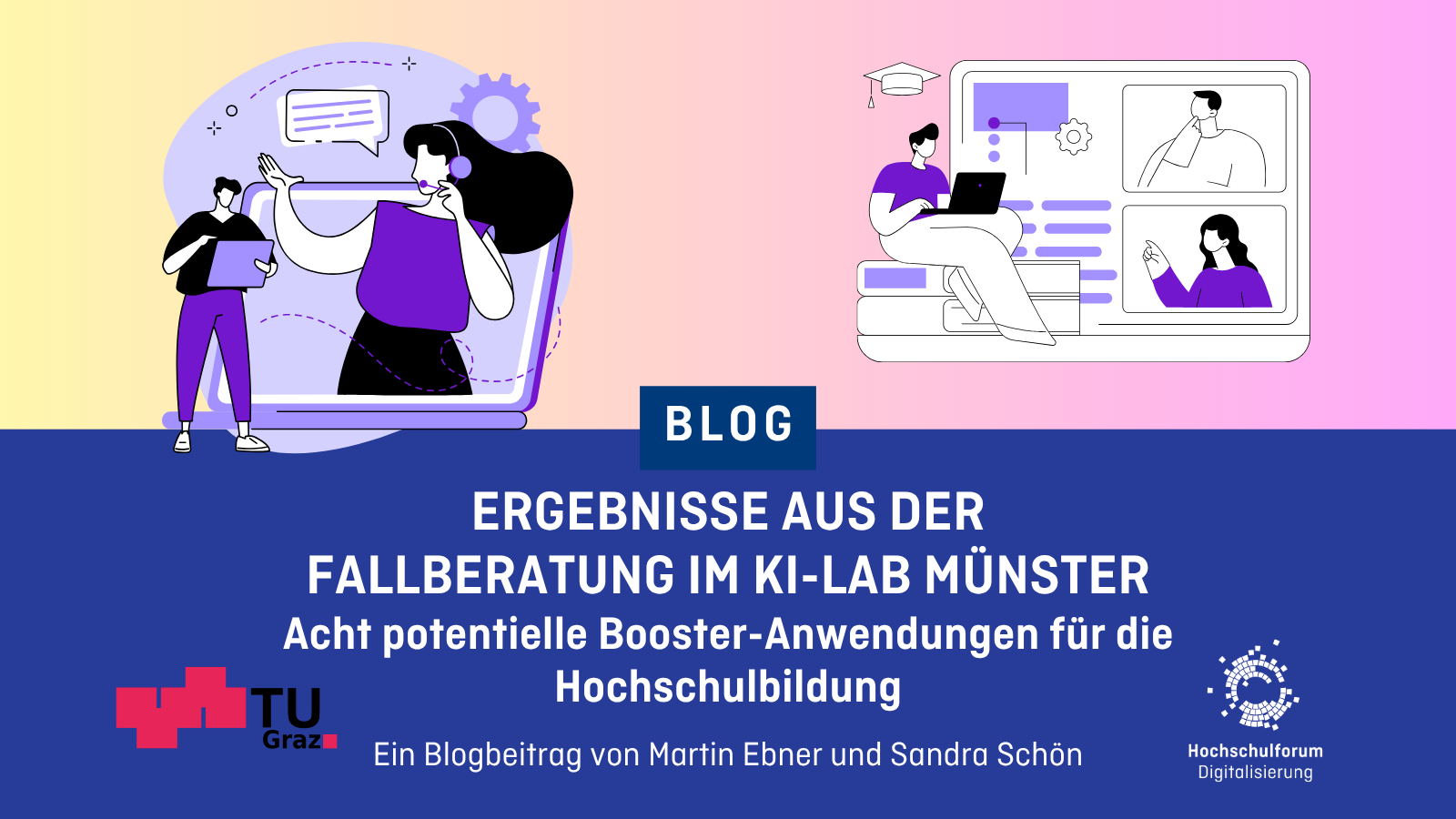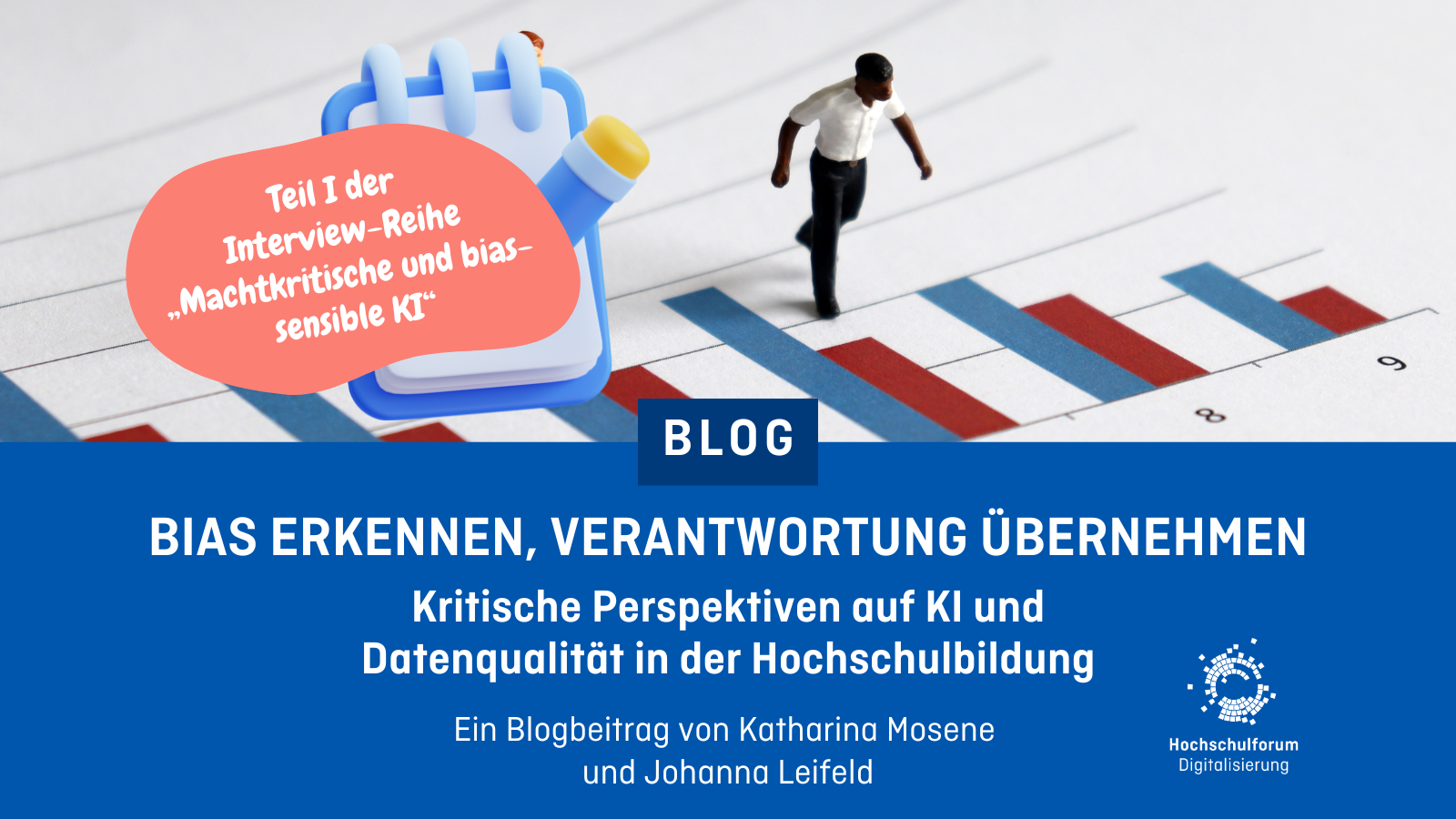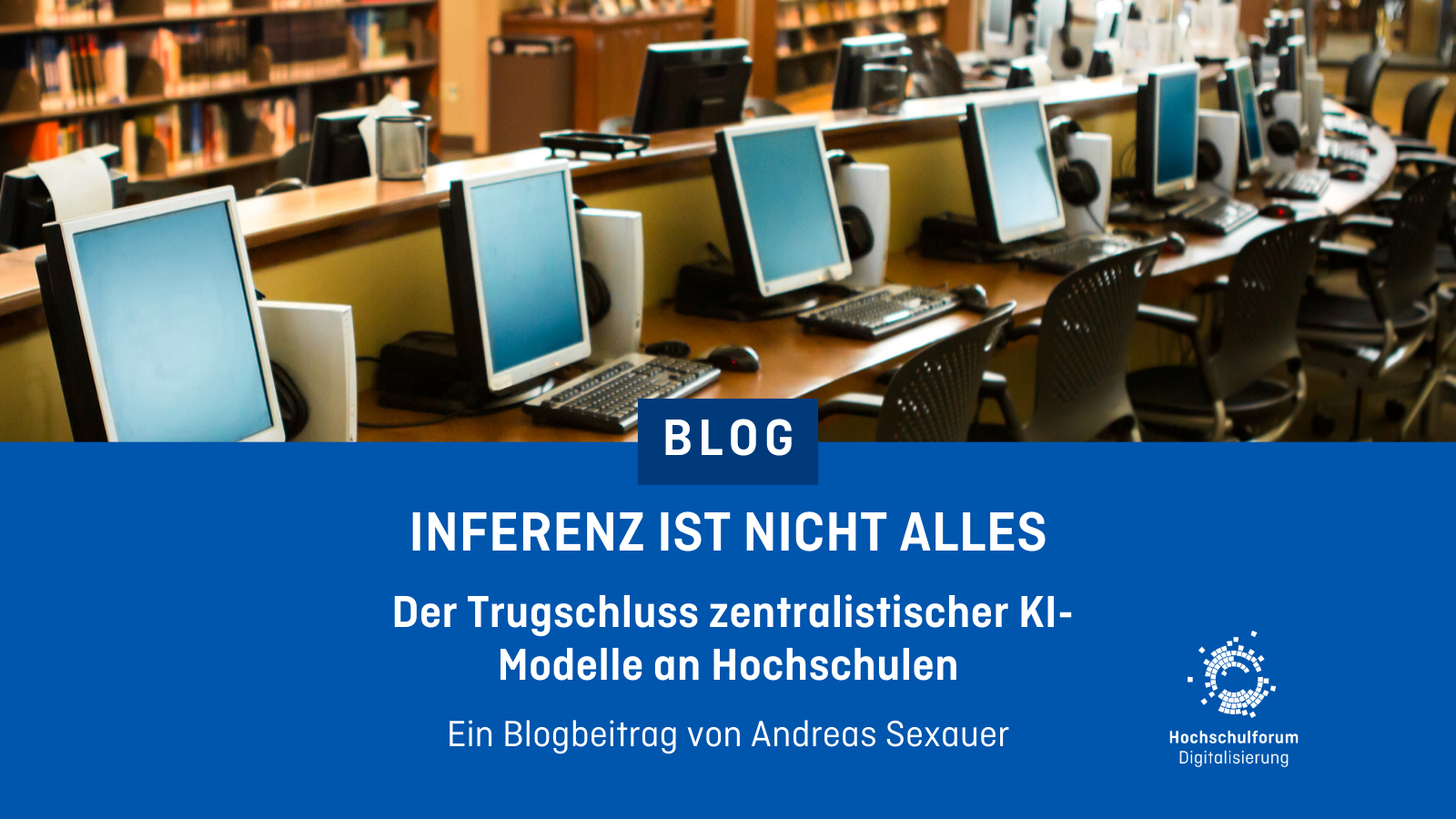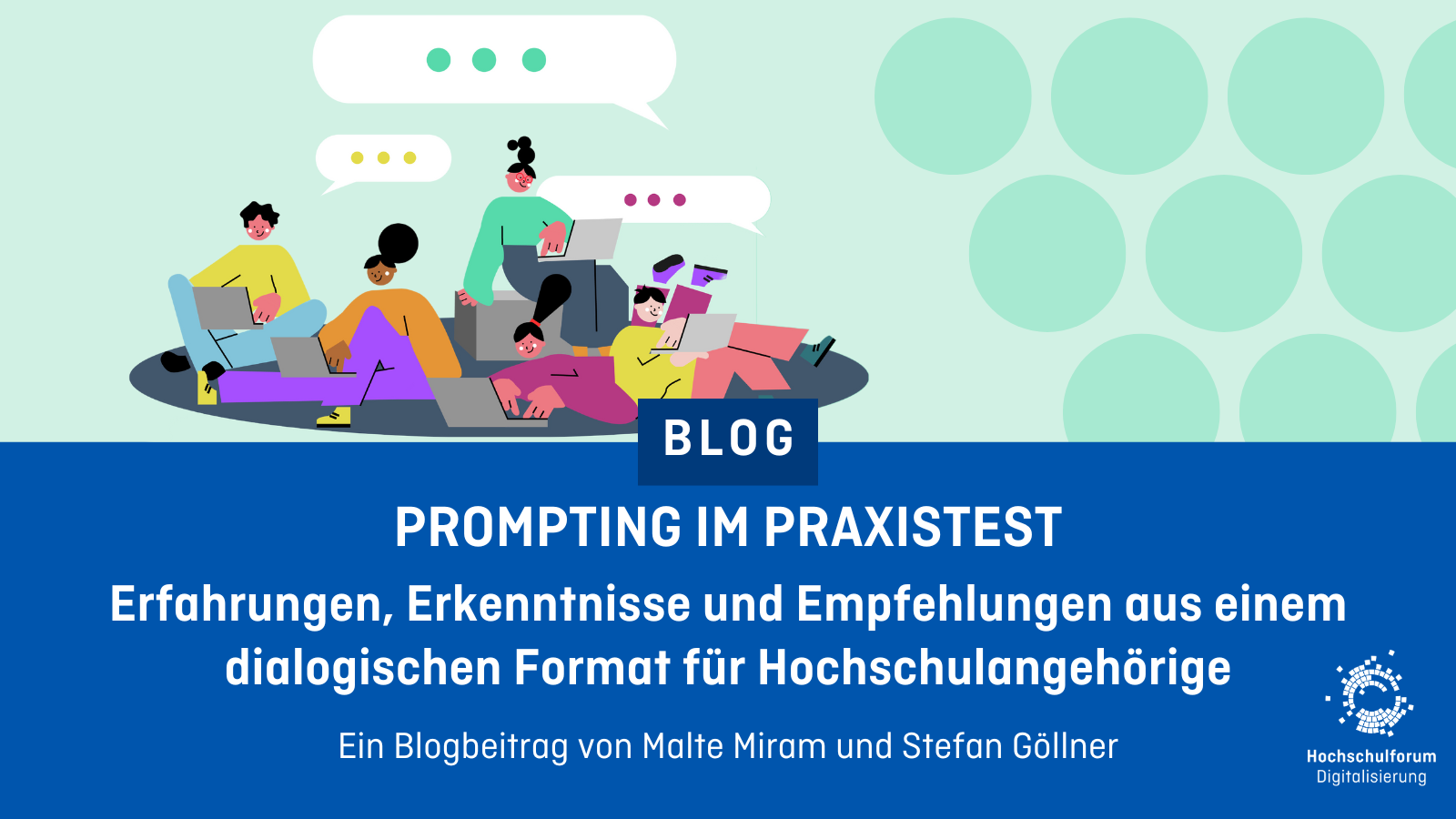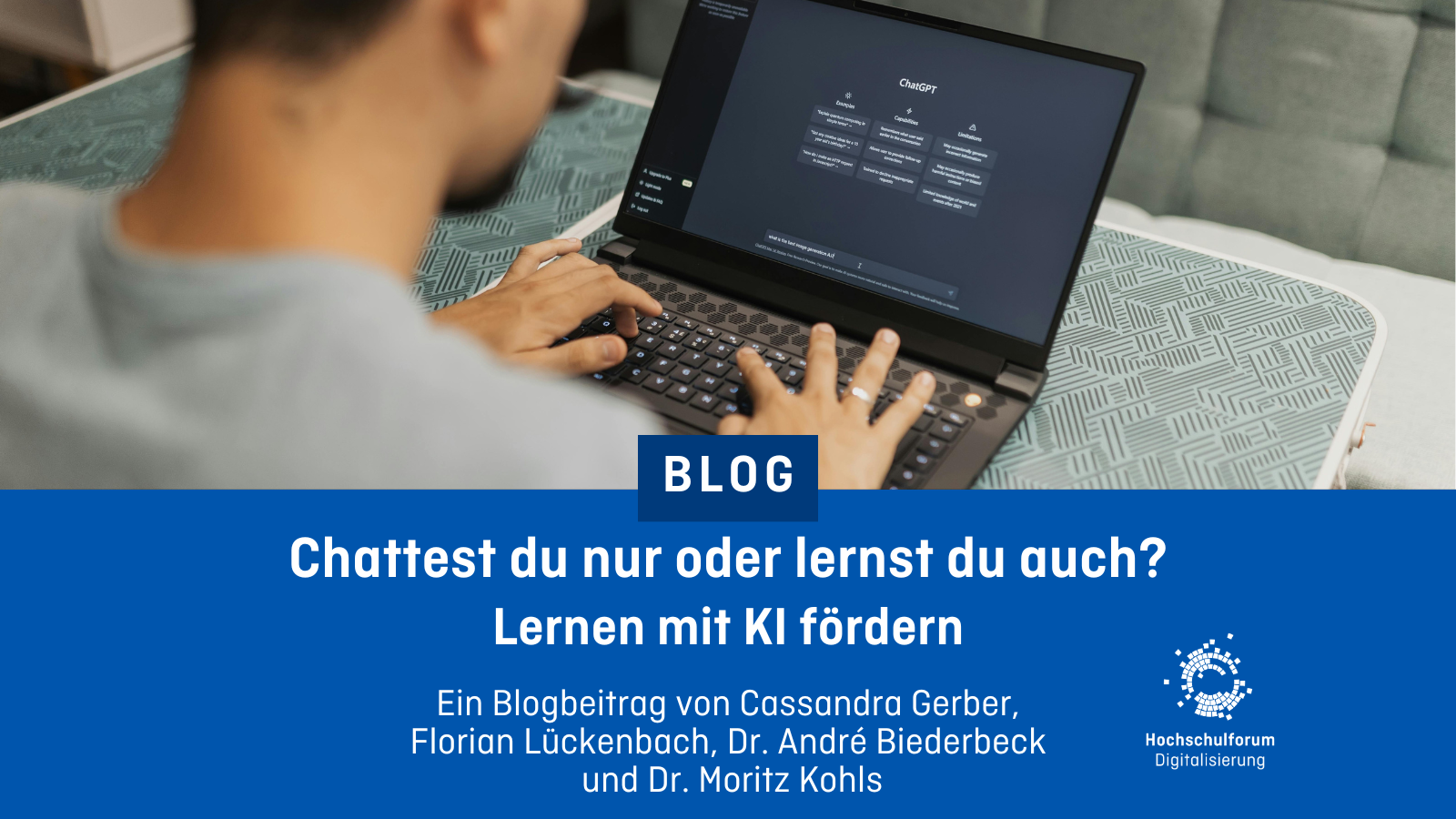Die DigitalChangeMaker über KI: Qualifizierung
Die DCMs befassen sich in vier Blogbeiträgen mit KI in der Hochschulbildung. In diesem geht es um das Thema Qualifizierung, denn hier hat sich insbesondere der rechtliche und gesellschaftliche Rahmen verschoben. Der EU AI Act ist in Kraft getreten und definiert die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hochschulen kommt deshalb eine zentrale Rolle zu, entsprechende Kompetenzen systematisch zu vermitteln.