Arbeitspapier Nr. 86: Künstliche Intelligenz: Grundlagen für das Handeln in der Hochschullehre
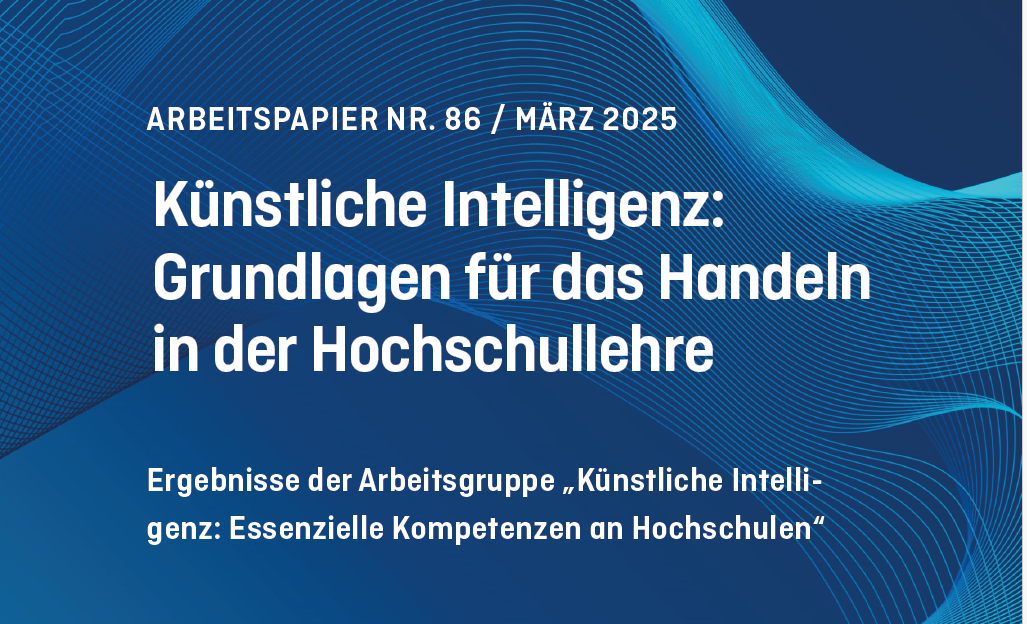
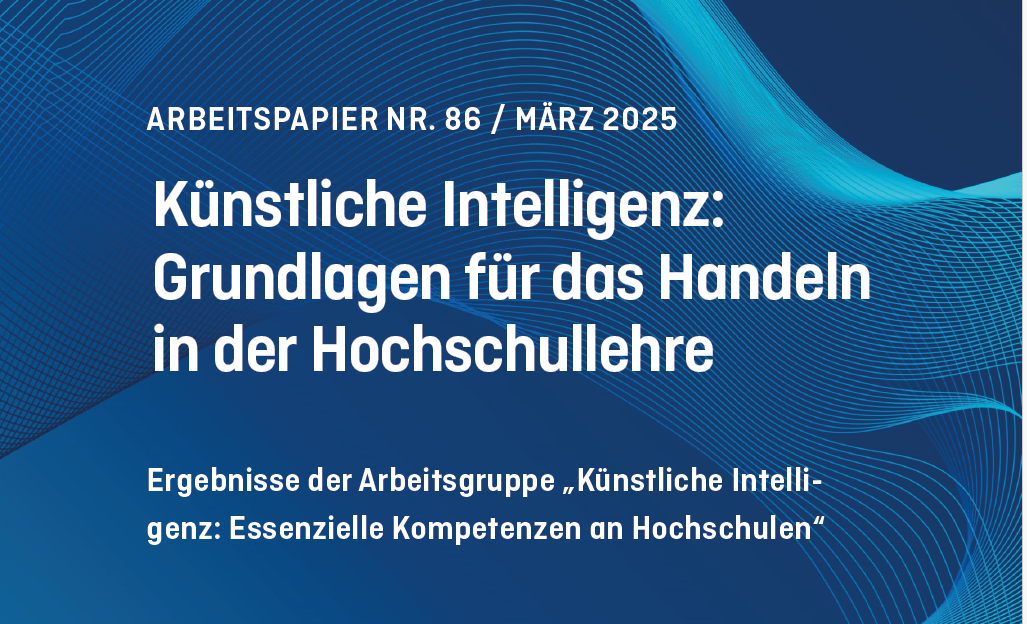
HAWKI2 entwickelt sich von einer datenschutzkonformen Schnittstelle zu generativer KI hin zu einem eigenständigen, hochschulspezifischen KI-Ökosystem. Ziel ist es, digitale Souveränität für Hochschulen zu fördern und Abhängigkeiten von kommerziellen Anbietern zu reduzieren. Durch ein nutzerzentriertes Design und den kontinuierlichen Austausch mit der Community werden neue Funktionen entwickelt, die auf die vielfältigen Bedürfnisse der Hochschulen eingehen.

Wie lassen sich Studiengänge so gestalten, dass sie nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern auch Kooperation und interdisziplinäres Denken fördern? In unserer Kolumne teilt Ulrike Tippe ihre Perspektive auf die kooperative Curriculumentwicklung – und stellt die Frage, welche Rolle klassische Studiengänge angesichts flexibler Lernwege und Microcredentials noch spielen. Warum es trotzdem durchdachte Curricula braucht, verdeutlicht sie mit einem ebenso einprägsamen wie alltagsnahen Vergleich.
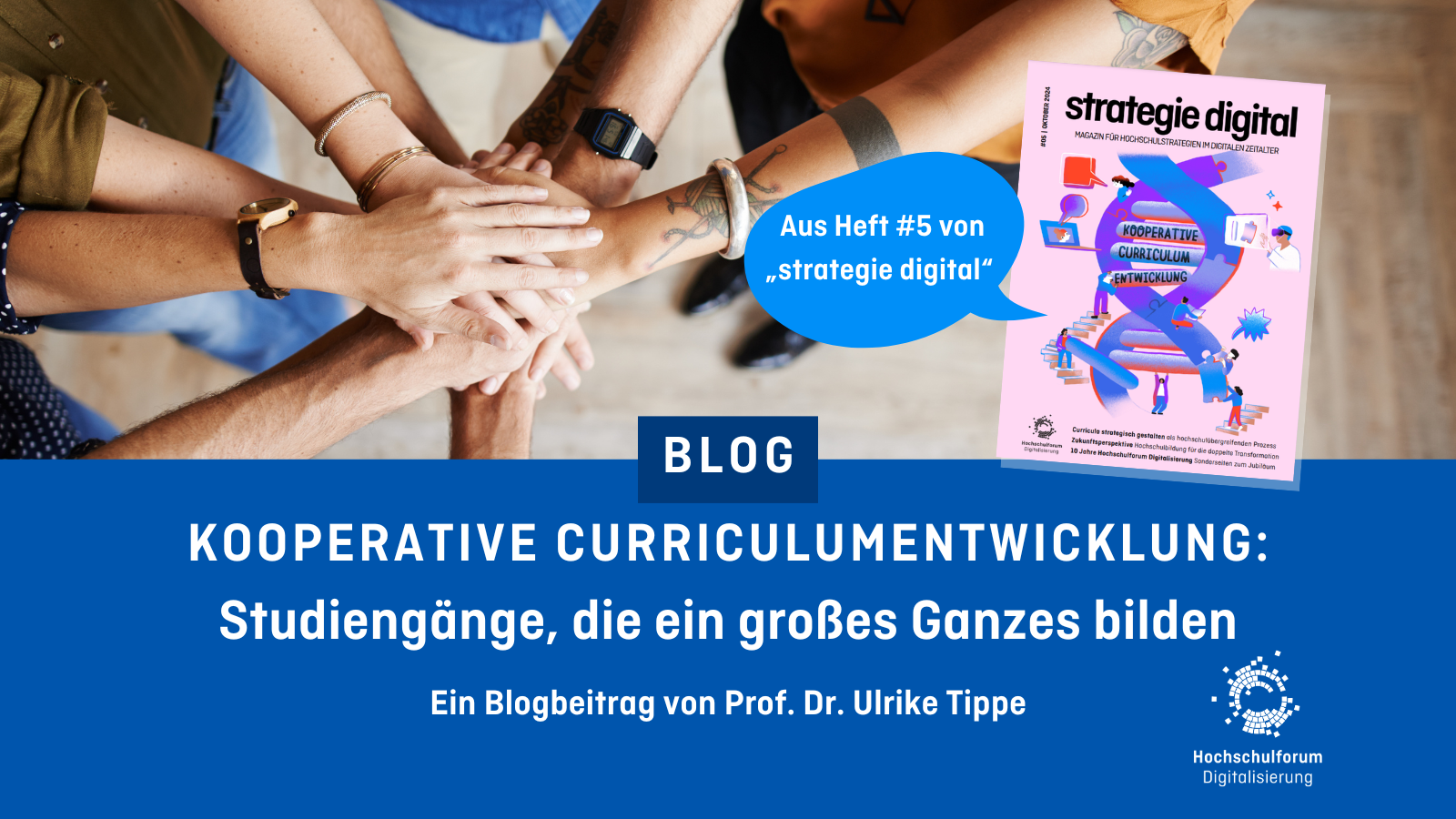

Die von CHE Consult im Auftrag des HFD erarbeitete Studie untersucht, wie Hochschulen Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam denken und umsetzen. Anhand von Expert:inneninterviews mit Hochschulleitungen und Personen in Leitungspositionen an den Schnittstellen zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung analysieren die Autorinnen Anna Gehlke und Dr. Ingeborg Lasser, welche Strategien Hochschulen entwickeln, welche Herausforderungen bestehen und wie sich Synergien zwischen beiden Transformationsfeldern gezielt nutzen lassen.
Jakob Radau, Miriam Maibaum und Doris Weßels analysieren die KI-Handreichungen deutscher Hochschulen aus studentischer Perspektive. Interviews mit 15 Studierenden zeigen, dass viele Regelwerke in der Anwendung zu Problemen führen oder abschreckend wirken können. Die Autor:innen beleuchten, welche Herausforderungen bestehen, welche Vorgaben Studierende vor Probleme stellen und welche Anpassungen erforderlich wären, um KI-Kompetenzen im Studium zu fördern.
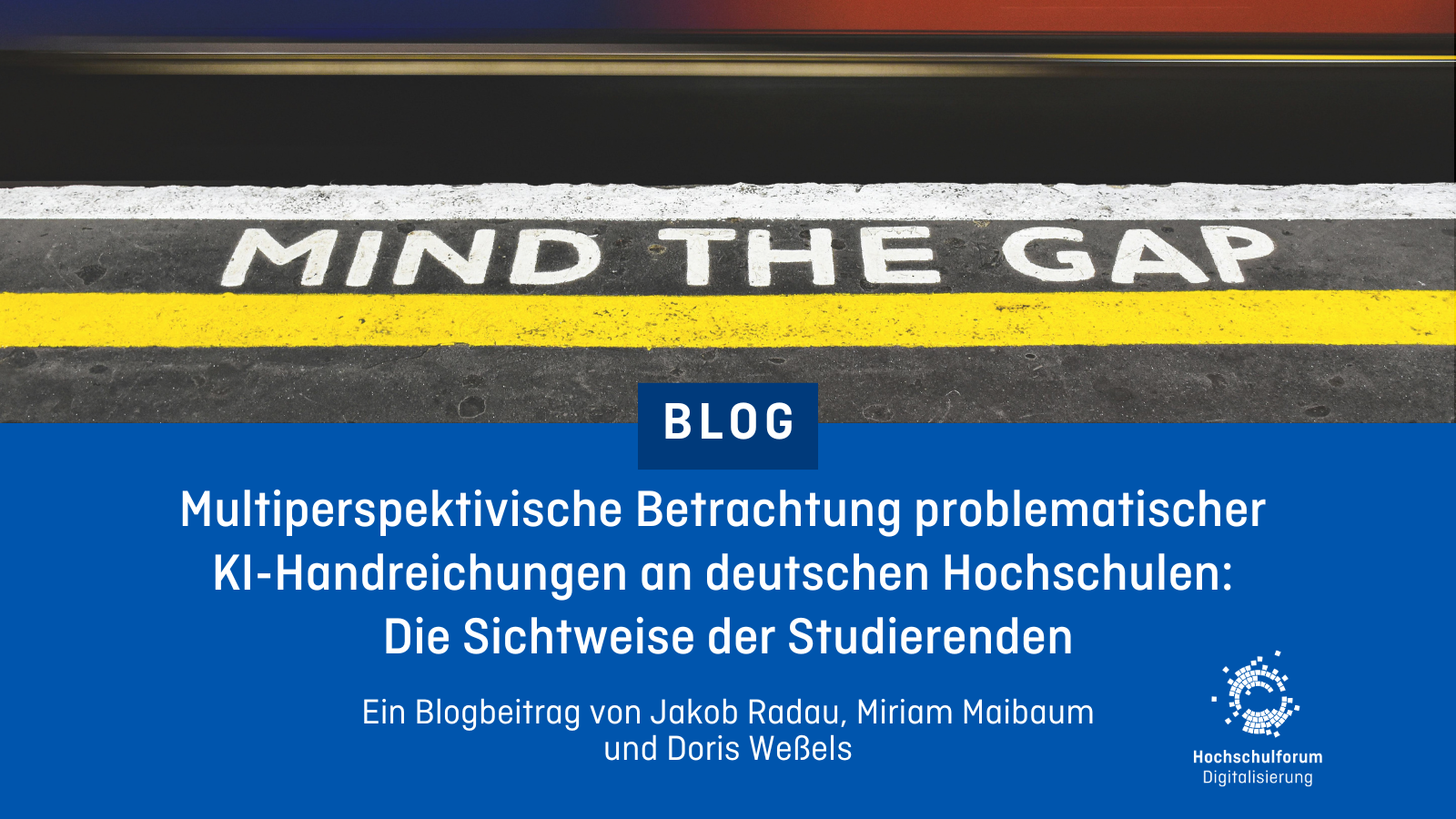

Der vorliegende Blickpunkt beleuchtet praxisnahe Ansätze aus dem Projekt Digitales kompetenzorientiertes Prüfen implementieren (ii.oo). Im Fokus stehen sechs inspirierende Good Practices zu Digitalen kompetenzorientierten Prüfungen, die sich durch die Förderung von Kompetenzentwicklung, praxisnahen Aufgaben und den sinnvollen Einsatz digitaler Tools auszeichnen.
Digitale Nachweise im Allgemeinen und Micro-Credentials im engeren Sinne sind zunehmend wichtige und vertrauenswürdige Instrumente für Hochschuleinrichtungen, die sich an die Anforderungen von lebenslang Lernenden und den sich wandelnden Arbeitsmarkt anpassen. Ihr Einsatz erweist sich als vorteilhaft für die Anerkennung von Lernergebnissen, die Mobilität von Studierenden, die Beschäftigungsfähigkeit und die Effizienz von Institutionen. Um die Terminologie und den Stand der Dinge auf europäischer Ebene zu verstehen und um herauszufinden, wie European Digital Credentials (EDC) einen Rahmen für die Verbesserung des Bildungsangebots an deutschen Hochschulen bieten können, haben wir uns an Ildiko Mazar und Kia Likitalo vom European Learning Model (ELM) Support Team gewandt.

New Work an Hochschulen bedeutet mehr als flexible Arbeitszeitmodelle: Es steht für einen umfassenden Kulturwandel. Im Interview mit Anne Prill (HFD) spricht Dr. Karoline Spelsberg-Papazoglou (Akademische Direktorin an der Folkwang Universität der Künste und Organisationsberaterin) über die Verknüpfung von Digitalisierung, Diversität und Partizipation als Erfolgsfaktoren für New Work und erklärt, wie Hochschulen diesen Wandel gemeinsam gestalten können. Ein Plädoyer für Mut, neue Führungskonzepte und die Kraft des Wandels – hin zu mehr Chancengerechtigkeit und Innovation.
