Welche Auswirkungen hat KI auf Prüfungen an Hochschulen?
Welche Auswirkungen hat KI auf Prüfungen an Hochschulen?
15.10.25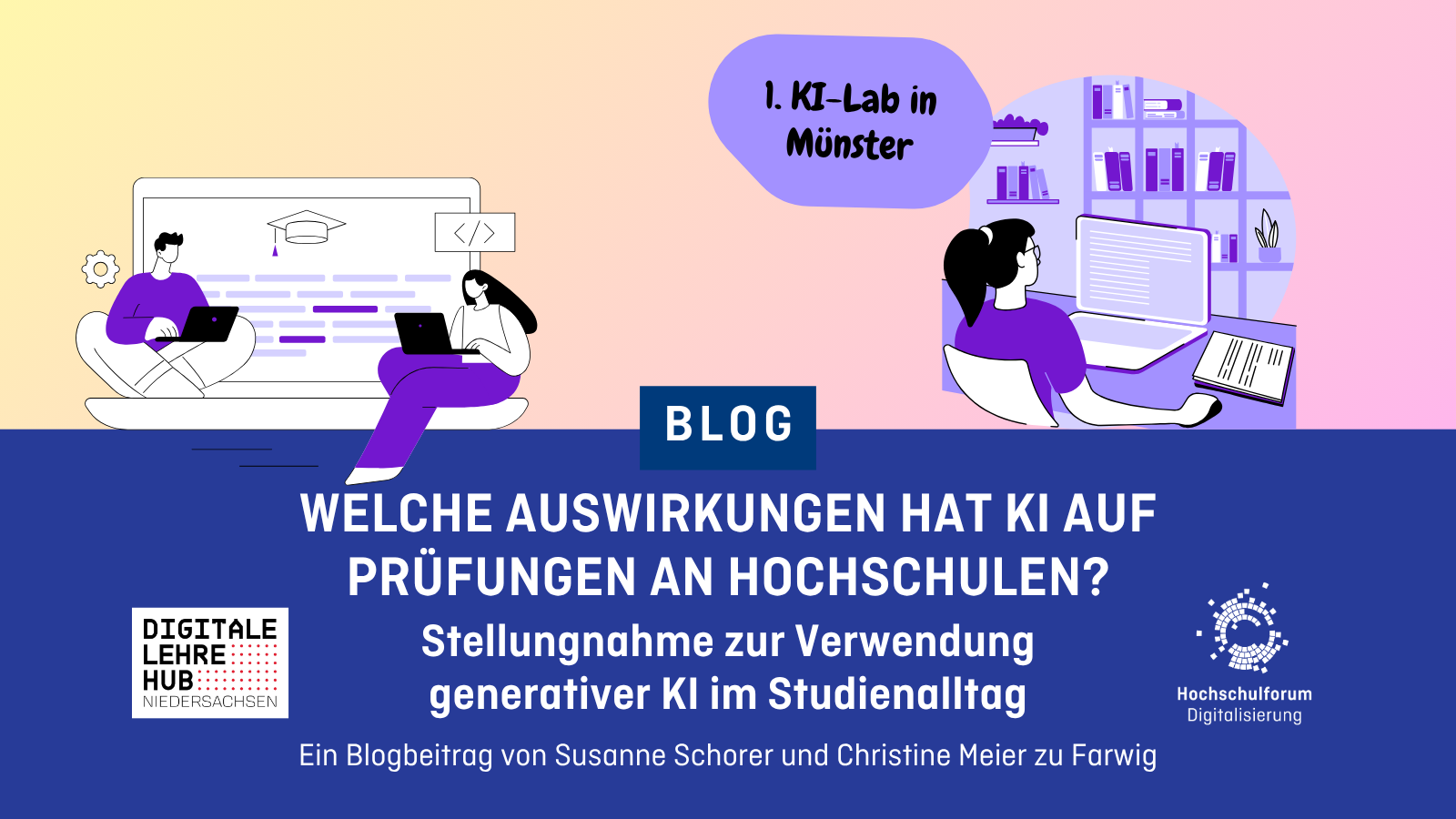
Wie können Hochschulen den Einsatz generativer KI in Prüfungen rechtssicher und didaktisch sinnvoll gestalten? Mit dieser Frage befassen sich Susanne Schorer und Christine Meier zu Farwig vom „Digitale Lehre Hub Niedersachsen“ (DLHN) in der AG Prüfungen. Beim 1. KI-Lab des HFD in Münster stellten sie ihre Stellungnahme zum Thema vor und erhielten Feedback von den Teilnehmenden. Das Papier versteht sich als Diskussionsgrundlage, die Hochschulen Orientierung für eigene Regelungen bietet – hochschulweit wie fachspezifisch, im Interesse von Lehrenden und Studierenden.
KI und Prüfungen – kaum ein Thema bewegt Hochschulen aktuell mehr. Während KI-Tools wie ChatGPT längst im Studienalltag angekommen sind, stehen Lehrende und Hochschulleitungen vor der Herausforderung, angemessene Regelungen zu finden. Sollen wir KI in Prüfungen verbieten? Wie dokumentieren Studierende den KI-Einsatz? Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten?
Im Projekt Digitale Lehre Hub Niedersachsen (DLHN) haben wir uns in der AG Prüfungen intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und eine Stellungnahme zum Einsatz generativer KI in Prüfungen erarbeitet.
Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg war unsere Teilnahme am KI-Lab in Münster, einer Veranstaltung des Hochschulforums Digitalisierung. Dort hatten wir die Gelegenheit, einen ersten Entwurf unserer Stellungnahme vorzustellen und wertvolles Feedback von Expert:innen zu erhalten.
Gemeinsam an komplexen Fragen arbeiten
Das KI-Lab bot uns einen Rahmen aus konzentrierter Workshoparbeit und hochkarätigen Expert:innen sowie eine wunderbare Arbeitsatmosphäre. Die Teilnehmenden kamen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, wodurch sich vielfältigen Perspektiven eröffneten und uns neue Blickwinkel auf das Thema und unsere Aufarbeitung angeboten wurden.
Für uns war es besonders wertvoll, unseren Entwurf in der Arbeitsgruppe vorzustellen und direktes Feedback zu erhalten. Die Rückmeldungen betrafen Aufbau und Strukturierung der Stellungnahme: Welche Themen sollten prominenter platziert werden? Wo mussten wir noch nachschärfen? Ein zentraler Aha-Moment war die Anregung, stärker herauszuarbeiten, was die europäische KI-Verordnung konkret für den Alltag von Lehrenden bedeutet. Dieser Hinweis führte dazu, dass wir das Kapitel zum KI-Einsatz durch Lehrende deutlich ausbauten und praktische Implikationen klarer herausstellten.
Insgesamt erhielten wir das Feedback, dass unsere Stellungnahme einen wertvollen Beitrag zur aktuellen Diskussion leistet. Das bestärkte uns darin, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen – und gleichzeitig die vorgeschlagenen Verbesserungen konsequent umzusetzen.
Wir möchten uns aus diesem Grund nochmal herzlich bei den Organisatoren des KI-Labs für dieses schöne Format und unsere Gruppe „Super 8“ für den hilfreichen Input bedanken.
Zentrale Empfehlungen der Stellungnahme
Nach der intensiven Überarbeitung können wir nun die fertige Stellungnahme vorlegen. Sie richtet sich an Hochschulen, Lehrende, Prüfungsgremien und hochschulpolitische Akteur:innen und will keine abschließenden Regelungen vorgeben, sondern differenzierte Handlungsspielräume aufzeigen. Im Fokus stehen zwei Perspektiven: der Einsatz von KI durch Studierende für Prüfungsleistungen und der Einsatz durch Lehrende im Rahmen der Prüfungsvorbereitung und -bewertung.
Prüfungsrecht trifft KI-Verordnung
Ein weiteres Augenmerk legt die Stellungnahme auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Herausforderung besteht darin, dass KI-generierte Inhalte weder Fremdleistungen im klassischen Sinne noch reine Eigenleistungen darstellen. Nach dem Grundsatz der Leistungserbringung müssen Prüfungsleistungen jedoch eigenständig und ohne unzulässige Hilfsmittel erbracht werden.
Erste Gerichtsurteile machen deutlich: Die ungekennzeichnete Verwendung von KI kann als Täuschungsversuch gewertet werden, selbst wenn es keine expliziten Regelungen in der Prüfungsordnung gibt. Gleichzeitig zeigt die Stellungnahme auf, dass generelle KI-Verbote weder rechtlich noch praktisch sinnvoll sind, da sie der Lehr- und Lernfreiheit widersprechen und zudem in unbeaufsichtigten Prüfungen kaum durchsetzbar sind.
Besonders relevant für Lehrende sind die Vorgaben der europäischen KI-Verordnung: Wird KI zur Prüfungsbewertung eingesetzt, kann dies schnell in den Hochrisiko-Bereich fallen – mit erheblichen Konsequenzen für die Hochschule. Die Stellungnahme erläutert detailliert, wann welche Pflichten greifen und welche datenschutzrechtlichen Aspekte zu beachten sind.
Mehr als nur ein Papier
Die Stellungnahme ist bewusst als Diskussionsgrundlage angelegt. Sie soll Hochschulen dabei unterstützen, hochschulweite und fachspezifische Regelungen zu entwickeln, die sowohl rechtssicher als auch didaktisch sinnvoll sind. Dafür gibt es keine Patentlösungen. Vielmehr braucht es einen differenzierten Umgang, der die Besonderheiten einzelner Fachkulturen und Prüfungsformate berücksichtigt.
Ein zentrales Anliegen ist es, Studierende nicht unter Generalverdacht zu stellen, sondern sie zu einem verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit KI zu befähigen. Dazu gehört auch, dass Hochschulen ausreichend Informations- und Schulungsangebote bereitstellen – sowohl für Studierende als auch für Lehrende.
Wie geht es weiter?
Mit der Veröffentlichung der Stellungnahme ist unsere Arbeit nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Wir verstehen sie als lebendiges Dokument, das den aktuellen Stand der Diskussion abbildet. Gleichzeitig entwickeln sich sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen rasant weiter. Daher werden wir die Stellungnahme in regelmäßigen Abständen bis zum Projektende in 2028 aktualisieren.
Die Stellungnahme steht unter einer offenen Lizenz (CC BY-SA 4.0) und kann frei verwendet, angepasst und weiterverbreitet werden. Wir hoffen, dass sie möglichst viele Hochschulen dabei unterstützt, den Umgang mit KI in Prüfungen konstruktiv zu gestalten.
Quellenangabe
Baresel, K., Horn, J., Schorer, S., Meier zu Farwig, C. & Schneider, J. (2025). Einsatz generativer KI in Prüfungen. Eine Stellungnahme. Herausgegeben vom „Digitale Lehre Hub Niedersachsen“. Lizenziert unter CC BY-SA 4.0. DOI: https://doi.org/10.57961/2rkb-fp35
Zum Projekt:
Der Digitale Lehre Hub Niedersachsen (DLHN) ist ein Verbundprojekt aller niedersächsischen Hochschulen. In verschiedenen Arbeitspaketen werden gemeinsam Themen rund um die digitale Transformation von Studium und Lehre bearbeitet. Die AG Prüfungen befasst sich insbesondere mit den Auswirkungen von KI auf Prüfungsprozesse.
Autor:innen

Susanne Schorer ist Mitarbeiterin im Digitale Lehre Hub Niedersachsen und arbeitet an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in der Stabsstelle Universitätsstrategie – Schwerpunkt Lehre. Ihre Arbeitsfelder umfassen KI in der Lehre, innovative Lehr- und Lerntools sowie Open Educational Resources (OER).

Christine Meier zu Farwig ist ebenfalls Mitarbeiterin im Digitale Lehre Hub Niedersachsen und arbeitet an der Hochschule Osnabrück im eLearning Competence Center. Ihre Themenschwerpunkte umfassen KI in der Lehre und Servicenetzwerke.


 Mauritz Danielsson
Mauritz Danielsson 
 Peter van der Hijden
Peter van der Hijden 
 Annalisa Biehl
Annalisa Biehl 