Die DigitalChangeMaker über KI: Lernen und Prüfen
Die DigitalChangeMaker über KI: Lernen und Prüfen
06.08.25
Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass wir im Rahmen eines Sprint-Prozesses studentische Forderungen zum Umgang mit KI an Hochschulen erarbeitet und veröffentlicht haben. Dabei haben wir damals explizit betont, dass diese Positionen einen Work-In-Progress darstellen, denn: Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die sich rasant weiterentwickelt und somit auch die Hochschulen zu Veränderungen antreibt. Nach einem Jahr wollen wir daher unsere Positionen erneut aufgreifen, überarbeiten und schärfen: Was hat sich verändert? Wo stehen wir vor allem mit Blick auf die studentischen Forderungen, jetzt und mittelfristig? Wo können und müssen die Positionen geschärft werden? Unsere überarbeiteten Positionen werden wir in diesem und drei weiteren Blogbeiträgen präsentieren. Bleibt gespannt auf neue Impulse, aber auch auf gestärkte Forderungen!
„Ist ChatGPT in diesem Seminar erlaubt?“ – „Zählt das als Täuschungsversuch?“ – „Muss ich KI-Einsatz angeben – und wenn ja, wie?“
Diese und ähnliche Fragen stellen sich viele Studierende nach wie vor täglich. Schon im vergangenen Jahr haben wir Hochschulleitungen unter anderem dazu aufgefordert, Leitlinien zu veröffentlichen, mit deren Hilfe sich Lehrende und Studierende über den Umgang mit KI informieren können. Unsere Hoffnung war: Orientierung für Studierende, Gestaltungsspielräume für Lehrende, mehr Klarheit für alle Beteiligten.
Ein Jahr nach Veröffentlichung unserer ursprünglichen Positionen und Forderungen beobachten wir: Auch wenn sich im vergangenen Jahr mehr Hochschulen zum Umgang mit KI positionierten, sind die Hochschulen, die entsprechende Leitlinien für Hochschulangehörige herausgeben, nach wie vor in der Minderheit. So zeigen Lindner und Weßels (2025), dass Ende des vergangenen Jahres nur rund 30% der Hochschulen über eine entsprechende Leitlinie verfügten.
Ein weiteres Problem, das sich mit Blick auf KI-bezogene Regelungen zeigt und auf das wir ebenfalls im Beitrag zum Thema Haltung & Partizipation verweisen: Wenn Leitlinien herausgegeben werden, wird die Verantwortung für Entscheidungen mit Blick auf den Umgang mit KI in der Lehre darin oftmals an die Fachbereiche und darüber nicht selten an einzelne Lehrende delegiert. Dies ist insofern nachvollziehbar und auch sinnvoll, als sich fachspezifische Bedarfe und Notwendigkeiten in Bezug auf die Reglementierung des Einsatzes von KI zeigen. Aus unserer Perspektive ergeben sich durch diese Praxis allerdings zwei Probleme mit Blick auf die Gestaltung von Lehre: Erstens, die Entwicklung von hochschulinternen Regelwüsten sowie, zweitens, eine weitere Zuspitzung ohnehin schon bestehender Grenzen und Schwächen der hochschulischen Lern- und Prüfungskultur. Darunter fallen etwa die Fixierung auf Endprodukte wie Hausarbeiten statt der Bewertung des Schreibprozesses oder die Überbetonung der Reproduktion von Wissen gegenüber Transfer und Reflexion.
Raus aus der Regelwüste
Sofern durch Leitlinien Entscheidungen zum Einsatz von KI in der Lehre an die Fachbereiche delegiert werden, die gegebenenfalls ihrerseits diese Verantwortung auf einzelne Lehrende übertragen, herrscht vielerorts weiterhin große Unsicherheit darüber, wie der Einsatz von KI im Studium rechtlich, praktisch und didaktisch einzuordnen ist. Studierende erleben ein Nebeneinander von stillschweigender Duldung, uneinheitlichen Regelungen und pauschalen Verboten. Zu wenig zielführenden Praktiken wie einem Pauschalverbot kommt die Angst vor Falschbeschuldigungen hinzu: Studierende befürchten beispielsweise, dass ihnen bei implizitem Verdacht auf den Einsatz von KI Notenabzüge unter anderen Vorwänden drohen – selbst wenn kein explizites Verbot ausgesprochen wurde oder keine Täuschung nachgewiesen werden kann. Das schafft nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern untergräbt auch das Vertrauen in faire und transparente Prüfungsverfahren. Der Status quo zeichnet damit immer noch ein Bild von uneinheitlichen, zum Teil intransparenten oder komplett fehlenden Regelungen, ergänzt mit pauschalen Verboten – willkommen in der Regelwüste!
Regelungen für den Umgang mit KI unterscheiden sich dabei nicht nur über Hochschulen, Fakultäten sowie einzelne Fachbereiche hinweg, sondern nicht selten auch innerhalb der Fächer mit Blick auf die einzelnen Veranstaltungen und Lehrenden. Während die Nutzung von KI in einer Lehrveranstaltung möglicherweise uneingeschränkt erlaubt ist, wird sie in einer anderen Veranstaltung – mitunter sogar im selben Modul – untersagt. Dies führt zu Orientierungslosigkeit, Verwirrung und Unsicherheit. Studierende müssen sich immer wieder neu damit auseinandersetzen, was in welchem Seminar erlaubt ist, ob eine Formulierung als Täuschungsversuch zählen könnte oder auch, inwiefern der KI-Einsatz im Rahmen einer Prüfungsleistung angegeben werden muss. Neben der Abwägung, bei entsprechender Intransparenz mögliche Konsequenzen für die eigene Benotung in Kauf zu nehmen, führt diese Praxis auch zu ungleichen Voraussetzungen – insbesondere beim Erwerb von KI-Kompetenzen.
Aber auch für Lehrende ergeben sich teils gravierende Konsequenzen: Durch den Mangel an soliden Vorgaben seitens der Hochschule bedarf es einer intensiven individuellen Auseinandersetzung mit der Thematik. Welche Regelungen sind in meiner Lehrveranstaltung sinnvoll und anwendbar? Wie kommuniziere ich diese? Und was kann oder muss ich tun, wenn KI unerlaubt genutzt wurde? Das kostet Zeit. Es scheint durchaus nachvollziehbar, dass die Nutzung von KI in diesen Fällen ohne Bedingungen zugelassen wird oder – und das passiert aus unserer Perspektive sehr viel häufiger – gänzlich untersagt. In dieser Situation verfehlen Leitlinien ihr eigenes Ziel, durch die Übertragung von Verantwortung bzw. Entscheidungen im Kontext von KI in Lehre und Prüfungen, Möglichkeitsräume zu schaffen. Diese werden in der Praxis eher verschlossen.
Damit sich dies ändert, fordern wir aufbauend auf unsere ursprünglichen Positionen:
- Hochschulleitungen müssen schriftliche Regelungen (z.B. eine Leitlinie) herausgeben, die Lehrende und Studierende über die Möglichkeiten zur Verwendung von KI in der Lehre informieren. Wir spezifizieren: Diese Leitlinien müssen einen klaren und verbindlichen Rahmen skizzieren, der kennzeichnet, was rechtlich erlaubt ist, wie KI-Nutzung deklariert werden kann und welche Mindeststandards für die Umsetzung in den Fakultäten gelten (z. B. zu Angaben in Modulhandbüchern, Prüfungsinformationen oder Eigenständigkeitserklärungen).
- Hochschulleitungen müssen die Umsetzung der Regelungen in den Fakultäten aktiv begleiten und einfordern – mit Unterstützung durch Didaktikzentren und unter Beteiligung von Studierenden. Die Erarbeitung und Durchführung darf nicht an die Fakultäten abgetreten werden, sondern bedarf hochschulweiter Koordination.
- Fakultäten und Fachbereiche sind in der Pflicht, die von den Hochschulleitungen vorgegebenen Möglichkeitsräume gemeinsam mit Studierenden konkret auszugestalten. Ziel ist eine praxisnahe, fachspezifische, einheitliche und verständliche Regelung der KI-Nutzung in Lehre und Prüfung. So zeigt sich bislang, dass an vielen Stellen von diesen Potenzialen nicht Gebrauch gemacht wird.
- Wenn Vorgaben erarbeitet und Entscheidungen getroffen werden, dann muss dies ebenso wie die daraus resultierenden Ergebnisse statusgruppenspezifisch und transparent kommuniziert werden: mit geeigneten Formaten, Kanälen und zielgruppengerechter Ansprache. Der KI-Hub der Universität Vechta zeigt beispielhaft, wie niedrigschwellige und formatübergreifende Informationsangebote für verschiedene Statusgruppen gelingen können. Der KI-Hub ist offen zugänglich, weshalb sich Studierende nicht erst durch interne Plattformen navigieren müssen, um an Informationen zu kommen. Außerdem wird klar unterschieden zwischen Ressourcen für Lehrende, Studierende und Verwaltung. Studierende finden gezielt Informationen, die ihre konkrete Situation betreffen, sowie Handlungsempfehlungen für den reflektierten Umgang mit KI.
Ein besonderer Fokus der Kommunikation, Aushandlung und Nutzung muss dabei auch auf der Kursebene liegen, denn in diesem Rahmen finden Lehre und Prüfungen konkret statt, weshalb hier ein Großteil der studentischen Unsicherheit entsteht. Dafür ist es zunächst notwendig, dass Rahmenbedingungen und Regelungen auf Fachbereichs- und Fakultätsebene etabliert werden, die dann von den Lehrenden für jede Veranstaltung zu Beginn an einem Ort (z.B. im Moodle-Kurs) klar festgehalten und kommuniziert werden müssen. Dabei sollte erläutert werden:
- ob und wie KI-Nutzung erlaubt ist,
- welche Tools zulässig sind,
- wie und wo KI-Nutzung deklariert werden soll,
- und wie Verstöße definiert und sanktioniert werden.
Im Idealfall bietet eine gemeinsame Ausgestaltung von Regelungen innerhalb der Veranstaltung die niedrigschwellige Möglichkeit, Studierende in den Prozess mit einzubeziehen. Dabei geht es eben nicht darum, pauschale Freigaben oder generelle Verbote auszusprechen. Vielmehr braucht es differenzierte Entscheidungen, die den fachlichen Kontext und die Prüfungsziele berücksichtigen.
Insgesamt halten wir deshalb weder ein Verbot von KI noch ein Verbot von KI-Verboten für sinnvoll. Der Einsatz von KI-gestützten Tools sollte im Studium grundsätzlich erlaubt und zugleich gezielt gesteuert sein – als integrierter Bestandteil von Hochschulbildung. Ein Verbot der KI-Nutzung in Lehr- oder Prüfungsformaten sollte nur dann zulässig sein, wenn der Lern- oder Prüfungszweck dies zwingend erfordert, wobei solche Einschränkungen transparent kommuniziert und nachvollziehbar begründet werden müssen. Ein Beispiel für ein zwingendes Verbot wären beispielsweise Übersetzungsklausuren, wo die Nutzung von Tools wie DeepL das Prüfungsziel verfehlt.
Auf dem Weg zu einer kompetenzorientierten Lern- und Prüfungskultur
Neben der Entwicklung und Implementierung von Regeln auf allen Hochschulebenen braucht es benötigt es auch einen Wandel der Lern- und Prüfungskultur per se. Denn: Anhand von KI wird deutlich, dass die bisherige Lern- und Prüfungskultur sich zu sehr an der Reproduktion von Wissen orientiert, statt sich der Überprüfung von Kompetenzen zu widmen.
Regelungen zu KI sollten deshalb nicht unter der Frage entwickelt werden, „Wie sichern wir am besten die bestehende Prüfungskultur ab?“, denn diese brachte schon lange vor KI grundlegende Probleme mit sich. Stattdessen sollten Hochschulen eine gestaltende Perspektive einnehmen, die sich an einer anderen Frage orientiert: „Welche Art von Prüfungen brauchen wir in einer Welt, in der Zukunftskompetenzen wie kritisches Denken und der reflektierte Umgang mit Technologien entscheidend sind?“. KI sollte unserer Meinung nach als Anlass genommen werden, endlich eine kompetenzorientierte Lern- und Prüfungskultur zu etablieren.
Unter einer kompetenzorientierten Prüfungskultur verstehen wir dabei Prüfungen, die sich nicht ausschließlich auf das Endprodukt fokussieren (wie es bei einer Seminararbeit der Fall ist), sondern den gesamten Lernprozess in den Blick nehmen: das Aneignen, Anwenden, Reflektieren und Weiterdenken von Wissen. Sie bereiten auf das vor, was in Forschung, Beruf und Gesellschaft gefragt ist: kritisches Denken, selbstständiges Arbeiten, Problemlösungskompetenz und der reflektierte Umgang mit digitalen Werkzeugen.
Solche Formate können zum Beispiel sein:
- projektbasierte Prüfungen mit praxisbezogenen Aufgabenstellungen,
- Lernjournale mit dokumentierten Denkwegen,
- mündlich-schriftliche Hybridformate, die Argumentation und Ausdruck kombinieren,
- Reflexionsaufgaben zum Einsatz von KI („Wie hat ChatGPT deinen Schreibprozess unterstützt – und an welchen Stellen nicht?“),
- forschendes Lernen, bei dem Studierende eigene Fragestellungen entwickeln und erforschen,
- Take-Home-Exams mit Komponenten, die individuelle Reflexion erfordern.
Entsprechende Prüfungen lassen sich nicht trotz, sondern gerade mit KI gestalten. Voraussetzung ist die Bereitschaft, Bestehendes zu hinterfragen und Studierende aktiv in diesen Prozess einzubeziehen. Um diesen Wandel strukturell zu begleiten, schlagen wir vor, dass Didaktikzentren, Fachbereiche und Studierende gemeinsam Leitlinien für kompetenzorientierte, „KI-kompatible“ Prüfungen entwickeln.
Zentrale Merkmale solcher Prüfungen wären unter anderem:
- Orientierung an Lernzielen statt an der Prüfungstradition,
- Fokus auf Anwendung, Reflexion und Transfer statt auf reiner Reproduktion,
- verlässliche Regelungen zur KI-Nutzung, die zwischen legitimer Unterstützung und Täuschung unterscheiden und klare Kriterien zur Reflexion und Deklaration von KI-Nutzung bieten
Nur wenn Prüfungsformate nicht mehr nur kontrollieren, sondern befähigen, entstehen Räume für das, was Hochschule eigentlich leisten soll: genuine Bildung statt inhaltliche Reproduktion.
Ein besonders gelungenes Beispiel für die partizipative Entwicklung von Regeln zur KI-Nutzung unter gleichzeitiger Kompetenzbildung in der Lehre ist unserer Meinung nach das Format „Prompt-Battle – zur Eigenständigkeitserklärung“ von Dr. Sanne Ziethen (Projekt Digital C@MPUS-le@rning, Universität Hildesheim). In dieser Veranstaltung setzen sich Lehrende und Studierende gemeinsam mit den Möglichkeiten und Grenzen generativer KI im wissenschaftlichen Arbeiten auseinander. In mehreren Runden testen Studierende KI-Prompts entlang der Phasen wissenschaftlichen Arbeitens, bewerten die Ergebnisse kritisch und diskutieren, wann der Einsatz von KI fachlich sinnvoll, problematisch oder unzulässig ist. Das Format mündet in einer gemeinsam formulierten Vereinbarung zum KI-Einsatz in der Lehrveranstaltung und den zugehörigen Prüfungen und kann etwa als Ergänzung zur Eigenständigkeitserklärung dienen. Die Stärke dieses Formats liegt darin, dass es durch die gemeinsame Aushandlung nicht nur Orientierung schafft, sondern Urteilsvermögen, Eigenverantwortung, Akzeptanz und kritische KI-Kompetenz fördert.
Fazit
Trotz der zunehmenden Etablierung von KI in der Arbeits- und Lebenswelt verharren viele Hochschulen unseres Erachtens weiterhin in einer abwartenden Haltung. Verantwortung wird weitergereicht, Verunsicherung nicht aufgelöst. Das trifft alle – sowohl Studierende, die nicht wissen, inwiefern KI-Einsatz erlaubt ist, als auch Lehrende, die oftmals ohne Orientierungshilfe agieren müssen. Um Unsicherheiten zu begegnen und Orientierung zu ermöglichen, ist die Überarbeitung von bestehenden Regelungen und Prüfungsformen unseres Erachtens dringend notwendig und längst überfällig. Sicherheit entsteht nur, wenn KI-Nutzung klar geregelt und didaktisch eingebettet wird. Was es jetzt braucht, sind Regelwerke, die Vertrauen ermöglichen, statt Kontrolle zu zementieren, Strukturen, die Lernräume schaffen und nicht nur Prüfungsräume verwalten, sowie den Mut zur Veränderung gemeinsam mit Studierenden.
Wir fordern jetzt:
1. Orientierung statt Verbote
Hochschulen sollen hochschulweite Leitlinien veröffentlichen, die Lehrenden wie Studierenden den didaktisch und rechtlich möglichen Umgang mit KI aufzeigen. Diese sollen Orientierung bieten, keine Generalverdachte unterstützen.
2. Transparenz auf Kursebene
Lehrende müssen für jede Veranstaltung klar kommunizieren, ob und wie KI-Tools genutzt werden dürfen – z. B. durch einen einheitlichen Hinweis im Moodle-Kurs oder durch Hinweis auf die Prüfungsordnung.
3. Kommunikationsstrategie
Hochschulen sollen Regelungen und Änderungen statusgruppenübergreifend, niedrigschwellig und zielgruppengerecht kommunizieren – über Kanäle, die im Alltag der Hochschulangehörigen tatsächlich genutzt werden. Austauschformate sollen Unsicherheiten adressieren und zur Mitgestaltung einladen.
4. Experimentierräume schaffen
Lehrende sollen ermutigt und unterstützt werden, KI-Tools in ihren Lehr- und Prüfungsformaten auszuprobieren – im Rahmen rechtlicher Möglichkeiten und in Absprache mit Studierenden.
5. Anpassung der Prüfungsordnungen
Prüfungsordnungen sollen hochschul- und fachspezifisch überarbeitet werden – partizipativ und praxisnah. KI-Nutzung muss sinnvoll integriert und nicht pauschal ausgeschlossen werden.
6. Partizipative Prüfungsentwicklung
Prüfungsformate sollen gemeinsam von Lehrenden und Studierenden überarbeitet werden – entlang der Lernziele und orientiert an den realen Anforderungen der Praxis.
7. Recht auf Nichtnutzung von KI sichern
Wer sich entscheidet, KI nicht zu nutzen, darf daraus keine Nachteile im Studium erfahren. Wir fordern klare Regelungen für das Recht auf Nichtnutzung als Teil der digitalen Selbstbestimmung.
Call to Action
Auch diese Position ist kein fertiger Entwurf, sondern ein Beitrag zum Diskurs – offen für Ergänzungen, Kritik und neue Perspektiven. Regelungen entstehen nicht im Vakuum oder hinter verschlossenen Türen, sondern im Dialog.
Deshalb laden wir euch ein, mitzudenken, mitzusprechen und mitzugestalten. Kennst du gelungene Beispiele für klare, faire und verständliche Regelungen zur KI-Nutzung an deiner Hochschule? Gibt es Leitlinien, Prüfungsformate oder Kommunikationswege, die Orientierung schaffen – oder Versuche, gemeinsam mit Studierenden neue Wege zu gehen? Teile deine Erfahrungen gern in den Kommentaren oder schick uns eine Nachricht via Mail.
Wenn du unsere Position teilst, hilf mit, sie sichtbar zu machen: Leite den Beitrag weiter, bring ihn in Diskussionen ein, nimm ihn mit in Gremien oder Teamrunden. Denn Haltung verändert sich nicht allein, sondern im Austausch.
Die neue Online-Befragung im Rahmen des studentischen KI-Sprints der DigitalChangeMaker-Initiative will studentische Perspektiven auf KI im Hochschulkontext sichtbar zu machen – differenziert, kritisch und konstruktiv. Jetzt an der Umfrage teilnehmen!
Autorinnen

Sarah Becker studiert im Master Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum mit einem persönlichen Fokus auf Technikphilosophie und Technikethik, insbesondere mit Schwerpunkt auf Bildungstechnologien und Künstliche Intelligenz. Dort arbeitet sie als studentische Mitarbeiterin in verschiedenen Projekten, berät Lehrende zu digitalen Lehr-Lernkonzepten und veranstaltet Workshops für Studierende zum Thema Künstliche Intelligenz. Sie setzt sich für studentische Partizipation im Diskurs zu generativer KI und für die Vermittlung von KI-Kompetenzen an Studierende ein.

Annalisa Biehl studiert im Master Erziehungswissenschaft an der Universität Münster. Neben ihrem Studium engagiert sich hochschulpolitisch in Fachschaft sowie AStA und arbeitet sie als Hilfskraft an den Universitäten Münster, Bielefeld sowie Konstanz. Im Rahmen dieser Tätigkeiten beschäftigt sie sich vornehmlich mit Fragen von Partizipation, Diversität und Nachhaltigkeit im Kontext von Lehrer:innenbildung und Hochschulforschung.
Lindner, M.; Weßels, D. (2025): Vom Problemfall zur Lösung: Zur Ausgestaltung von Richtlinien zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz an Hochschulen, Forschung & Lehre, Ausgabe 2/2025, S. 32-35, https://www.forschung-und-lehre.de/heftarchiv/ausgabe-2/25, aufgerufen am 10.07.25.
Radau, J.; Maibaum, M.; Weßels, D. (2025): Multiperspektivische Betrachtung problematischer KI-Handreichungen an deutschen Hochschulen – die Sichtweise der Studierenden, Blogbeitrag Hochschulforum Digitalisierung: https://hochschulforumdigitalisierung.de/multiperspektivische-betrachtung-problematischer-ki-handreichungen/, veröffentlicht am 27.02.25, aufgerufen am 10.07.25.
KI-Hub der Universität Vechta: https://www.uni-vechta.de/ki-hub, aufgerufen am 10.07.25.
„Prompt-Battle – zur Eigenständigkeitserklärung“ von Dr. Sanne Ziethen (Projekt Digital C@MPUS-le@rning, Universität Hildesheim): https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/digitale-delikatessen-lets-talk-about-ki-prompt-battle-zur-eigenstaendigkeitserklaerung/, aufgerufen am 10.07.25.





 Mauritz Danielsson
Mauritz Danielsson 
 Peter van der Hijden
Peter van der Hijden 
 Steve Joordens
Steve Joordens 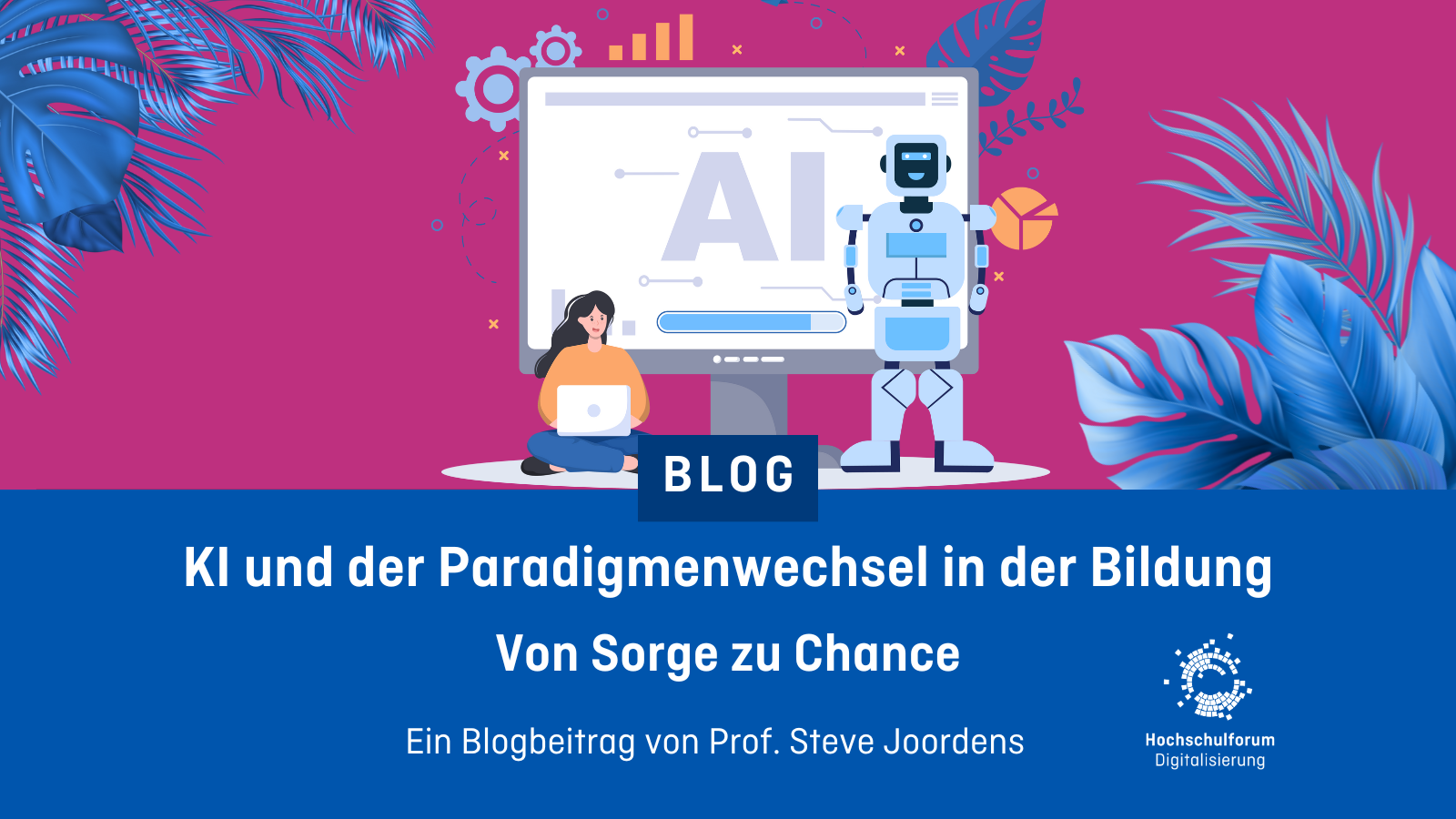
Chapeau, liebe Frau Becker, liebe Frau Biehl, ich finde Ihren Beitrag wirklich ’spot-on‘.
Soweit ich das sehe, haben wir an unserer Einrichtung viele Ihrer Beobachtungen und Forderungen bereits umgesetzt (siehe hier am unteren Ende der Seite: https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/hochschule/einrichtungen/zentrum-fuer-qualitaetsverbesserung-studium-und-lehre-zfq/angebot-fuer-11) ; andere Forderungen aber nehme ich gerne auch mit in die interne Diskussion.
Ein Recht der Lernenden auf Nichtnutzung von KI beispielsweise (im Kontext dessen, was gemeinhin als digitale Selbstbestimmung im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes diskutiert wird) ist ein wichtiger (wenn auch kontroverser) Punkt. In der Tat kann bei uns eine bestimmte KI-Werkzeugnutzung als „erforderlich“ definiert werden. Was aber, wenn ein(e) Studierende(r) die Leistung ohne KI erbringen will? Sollte in solchen Fällen eine alternative Prüfungsforme angeboten werden – evtl. bis hin zum Nachteilsausgleich? Just vorgestern hatten wir dazu eine spannende Konferenzsession im Rahmen der LAID25.