Die DigitalChangeMaker über KI: Qualifizierung
Die DigitalChangeMaker über KI: Qualifizierung
23.10.25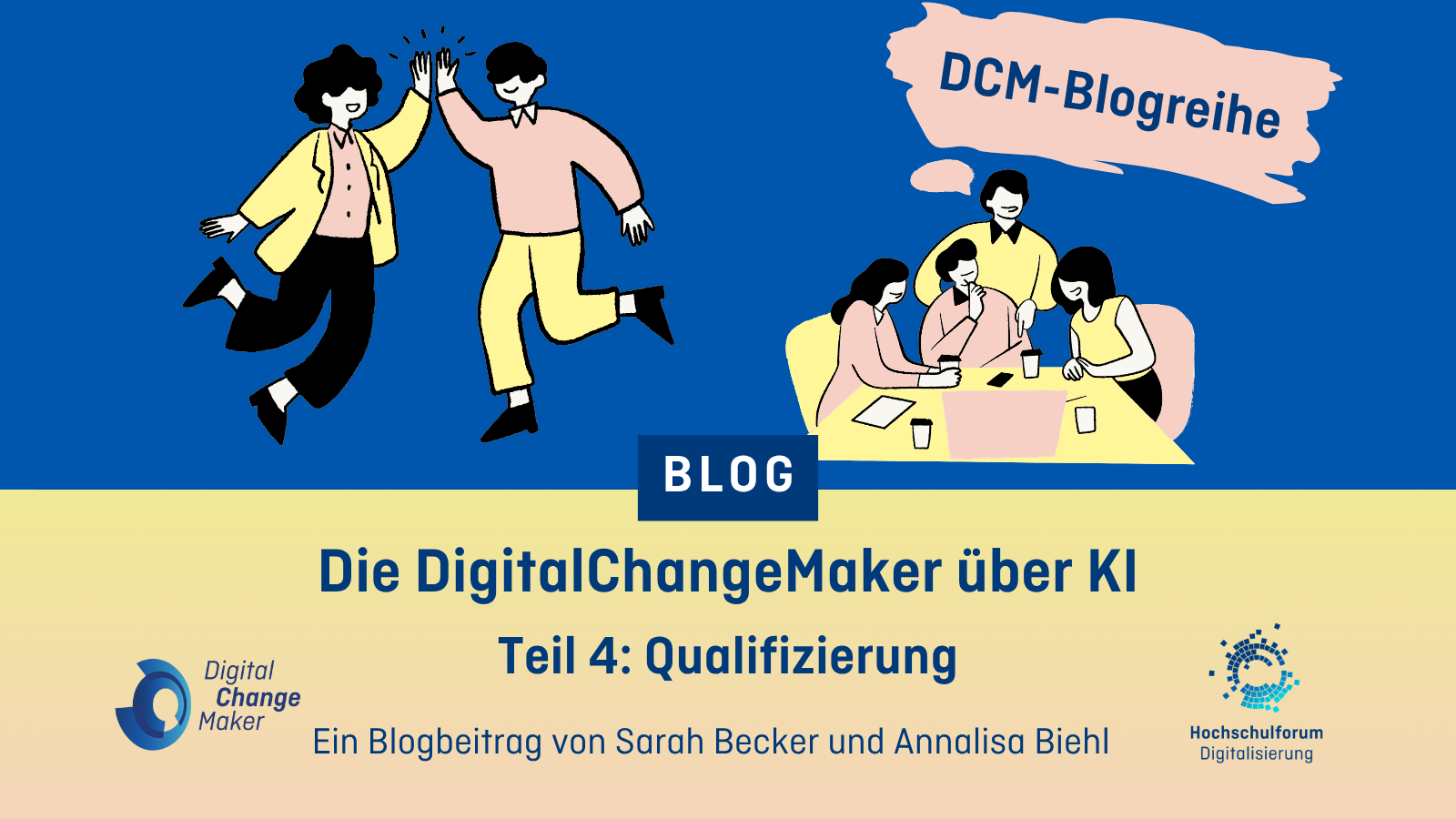
Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass wir im Rahmen eines Sprint-Prozesses studentische Forderungen zum Umgang mit KI an Hochschulen erarbeitet und veröffentlicht haben. Dabei haben wir damals explizit betont, dass diese Positionen einen Work-In-Progress darstellen, denn: Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die sich rasant weiterentwickelt und somit auch die Hochschulen zu Veränderungen antreibt. Nach einem Jahr wollen wir daher unsere Positionen erneut aufgreifen, überarbeiten und schärfen: Was hat sich verändert? Wo stehen wir vor allem mit Blick auf die studentischen Forderungen, jetzt und mittelfristig? Wo können und müssen die Positionen geschärft werden? Unsere überarbeiteten Positionen werden wir in diesem und den drei anderen Blogbeiträgen präsentieren. Bleibt gespannt auf neue Impulse, aber auch auf gestärkte Forderungen!
Wie auch in Bezug auf die anderen drei Themenfelder, die wir im Rahmen dieser Blogreihe zum KI-Sprint aufgegriffen haben, zeigt sich ein Jahr nach Veröffentlichung unserer ursprünglichen Positionen und Forderungen: Es hat sich etwas bewegt. Für das Themenfeld Qualifizierung hat sich insbesondere der rechtliche und gesellschaftliche Rahmen verschoben. Der EU AI Act ist in Kraft getreten und definiert die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hochschulen kommt dabei eine zentrale Rolle zu, entsprechende Kompetenzen systematisch zu vermitteln.
Ein Blick auf den Status Quo zeigt jedoch eine deutliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität: Viele Studierende eignen sich Kompetenzen im Bereich KI weiterhin autodidaktisch oder außerhalb der Hochschulen an, während Lehrende häufig unsicher sind, wie sie KI didaktisch und rechtlich reflektiert in ihre Lehre integrieren können. Darauf verweisen auch Daten aus verschiedenen Studien, die zwar noch vor dem Inkrafttreten des EU AI Acts erhoben wurden, aber dennoch zeigen, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht:
- Im CHE-Check KI (Hüsch et al., 2025) bewerten Studierende das Angebot zum Erwerb von KI-Kompetenzen ihrer Hochschule beziehungsweise ihres Fachbereichs im Schnitt nur mit 2,7 von 5 Sternen. Besonders in nicht-technischen Fächern bleiben die Bewertungen oft unterdurchschnittlich.
- Laut einer Studierendenbefragung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (Ehlers & Rauch, 2024) fühlen sich ausschließlich 1,3 % der Befragten sehr gut sowie 8,4 % gut auf den Umgang mit KI durch das Studium vorbereitet. 75,6 % der Studierenden geben hingegen an, sich „nicht gut“ oder „gar nicht gut“ vorbereitet zu fühlen. Im Gegensatz dazu steht, dass circa 60 % der Studierenden ihre Fähigkeiten im Umgang mit KI als sehr sicher oder sicher einschätzen. Ehlers & Rauch (2024) schließen daraus, dass die Studierenden ihre Kompetenzen weitgehend eigenständig und außerhalb des Studiums entwickelt haben.
Die Zahlen zeigen: Hochschulen stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe, den Kompetenzaufbau im Sinne des AI Acts und der aktuellen Anforderungen wirksam zu gestalten. Eine bloß randständige Behandlung des Themas oder vereinzelte Angebote genügen hierfür nicht. Vielmehr wird ein struktureller Ausbau des Qualifizierungsangebots gebraucht, eine kontinuierliche Weiterentwicklung sowie eine bedarfsgerechte Ausrichtung auf alle Statusgruppen an der Hochschule – von Studierenden über Lehrende bis hin zu Mitarbeitenden in Technik und Verwaltung. Das folgende Good Practice-Beispiel zeigt aus unserer Perspektive exemplarisch, wie ein Einzelprojekt Impulse für eine strukturelle Verankerung von KI in Lehre und Hochschulentwicklung geben kann.
Studentische KI-Tutor:innen in Bayern / AI Guides an der TUM – und was Hochschulen daraus lernen können
Unser Good Practice-Beispiel – genauer gesagt zwei eng verbundene Initiativen – sind die KI-Tutor:innen Bayern und die AI Guide Academy an der Technischen Universität München (TUM). Das Konzept beider Projekte ist einfach: Studierende agieren in den Projekten als KI-Multiplikator:innen und Peer-Lernende, um Digital- und KI-Kompetenz an ihre Hochschulen zu bringen. Dafür nehmen sie zunächst selbst an Workshops und Trainings teil, worin sie in Themen (wie z.B. den Grundlagen von KI) geschult werden und anhand praxisnaher Anwendungsbeispiele lernen. Auch ethische Themen wie Datenschutz, Fairness und gesellschaftliche Verantwortung sind Teil der Qualifizierung. Dieses Wissen geben die ausgebildeten Studierenden als Multiplikator:innen in Workshops, Tutorien und Lerngruppen an Lehrende und Studierende im Sinne eines dezentralen Wissenstransfers weiter.
Die KI-Tutor:innen Bayern und die AI Guide Academy an der TUM sind für uns deshalb ein Good Practice-Beispiel, weil sieviele der Herausforderungen adressieren, die wir in unseren ursprünglichen Forderungen beschrieben haben:
1. Vom Einzelprojekt zur strukturellen Verantwortung
Ein zentrales Problem an Hochschulen besteht unseres Erachtens darin, dass Angebote zur Qualifizierung aktuell oftmals noch als einzelne Veranstaltungen angeboten werden. Die vorgestellten Projekte setzen dem eine dauerhaft angelegte Multiplikator:innen-Struktur entgegen, die in den Hochschulalltag integriert ist und den kontinuierlichen Aufbau von KI-Kompetenzen unter den Hochschulangehörigen unterstützt.
2. Partizipation und Peer-Learning auf Augenhöhe
Das Modell setzt auf Peer-Learning und Partizipation: Studierende werden als KI-Multiplikator:innen qualifiziert, geben ihr Wissen an ihre Peers weiter und unterstützen darüber hinaus Lehrende bei der Integration von KI in der Lehre. So entsteht eine kooperative Lernstruktur, in der beide Statusgruppen voneinander lernen und profitieren. Damit greift das Modell eine zentrale Forderung aus Themenfeld 1 (Haltung & Partizipation) auf: Studierende als Akteur:innen im Diskurs ernst zu nehmen.
3. Zugänge erleichtern, Kompetenzen erweitern
Eine häufige Herausforderung in der KI-Qualifizierung ist aus unserer Sicht die Zugänglichkeit: Viele Angebote sind entweder zu technikzentriert oder zu abstrakt, um alle Statusgruppen anzusprechen. Die AI Guide Academy begegnet dem mit niedrigschwelligen Formaten wie Tutorien, Lerngruppen und Workshops, die durch Peer-to-Peer-Lernen den Zugang erleichtern – auch für Personen mit Berührungsängsten gegenüber KI. Zudem sieht das Angebot neben der Vermittlung von technischem Wissen auch den Erwerb von KI-Kompetenzen in einem weiteren Sinne vor. Entsprechend werden die Multiplikator:innen nicht nur im Umgang mit KI-Tools ausgebildet, sondern im Fokus stehen auch AI Literacy und Data Literacy. Darunter verstehen wir:
technisches Verständnis (zum Beispiel Funktionsweise von KI, Trainingsdaten, Prompting, Wirkungsabschätzung)
Datenkompetenz (zum Beispiel Bias-Erkennung, Datenschutz, Datenqualität, Statistik)
ethische Reflexion (zum Beispiel Fairness, Verantwortung, Auswirkungen auf die Gesellschaft)
Diskurskompetenz (zum Beispiel kommunikativer Umgang mit Unsicherheiten, Gestaltung von KI-Prozessen, kritisches Hinterfragen und gemeinsames Aushandeln von KI-Nutzung)
Damit setzt die AI Guide Academy genau das um, was wir fordern: KI-Kompetenzen zum einen als Future Skills ganzheitlich zu denken, und zum anderen als Breitenkompetenzen zu etablieren, sodass nicht nur Studierende einzelner Studiengänge auf den Umgang mit KI vorbereitet werden (vgl. Hüsch et al., 2024; 2025).
4. Peer-Formate entlasten Lehrende und schaffen Anreize.
Das Modell der studentischen Multiplikator:innen kann aus unserer Perspektive ein weiteres Problem lösen: Viele Lehrende sind unsicher, wie sie KI in ihre Lehre integrieren sollen oder haben schlicht keine Zeit, sich umfassend fortzubilden. Die AI Guide Academy entlastet Lehrende, indem sie studentische Hilfskräfte als AI Guides einbindet, die bei der didaktischen Integration von KI unterstützen und deren Finanzierung durch die Hochschule unterstützt wird. Das ist ein positives Beispiel für Anreizsysteme, wie wir sie gefordert haben: monetär, aber auch organisatorisch, denn es entkoppelt KI-Qualifizierung von Überforderung und Zeitmangel, sodass Lehrende dies hoffentlich weniger als zusätzliche Belastung empfinden.
5. Nachhaltige Strukturen schaffen – zentral und dezentral
Die Projekte zeigen, wie nachhaltige Strukturen zur KI-Qualifizierung sowohl zentral als auch dezentral verankert werden können. Auf zentraler Ebene an der TUM übernimmt ProLehre | Medien und Didaktik die strategische Steuerung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Angebote für beteiligte Studierende. Dezentral wirken die studentischen AI Guides als Multiplikator:innen, die Wissen weitergeben, Lehr- und Lernprozesse begleiten und den Austausch zwischen Statusgruppen unterstützen.
Durch diese Aufgabenteilung wird KI nicht nur als ergänzendes Thema behandelt, sondern fachübergreifend in den Studienalltag eingebunden. Die AI Guides bringen ihre Perspektive als Studierende ein, beraten Lehrende bei didaktischen Fragen und unterstützen bei der Entwicklung geeigneter Formate und Prüfungsformen. Damit wird die Forderung nach Transfer- und Beratungsstellen auf mehreren Ebenen praktisch umgesetzt sowie der Aufbau einer Lernenden Organisation mit einer gelebten partizipativen Curriculumsentwicklung aktiv gestaltet.
6. Studierende als Teil der Lösung
Besonders hervorheben möchten wir im Rückblick auf unseren Beitrag zum Themenfeld Haltung und Partizipation auch, dass Formate wie die AI Guide Academy einen wichtigen Perspektivwechsel einleiten. In unserem ersten Beitrag haben wir betont: Der Diskurs rund um KI an Hochschulen ist oft davon geprägt, über Studierende zu sprechen – nicht mit ihnen. Studierende werden dabei wahlweise als unkritische Nutzer:innen oder als potenzielle Täuschende dargestellt. Diese defizitorientierten Zuschreibungen prägen den Alltag in Hochschulen. Die AI Guide Academy bricht mit dieser Praxis. Studierende werden hier nicht als Problem behandelt, sondern als Mitgestaltende und Multiplikator:innen für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz in Studium und Lehre. So kann eine Kultur entstehen, in der Studierende Teil der Lösung sind, und nicht das Problem.
Fazit
Das Good Practice-Beispiel zeigt, dass zentrale Forderungen aus unseren ursprünglichen Forderungen zum Umgang mit KI an Hochschulen praktisch umsetzbar sind. Und es macht deutlich, wie Hochschulen den Herausforderungen der KI-Qualifizierung niedrigschwellig, partizipativ und mit längerfristiger Perspektive begegnen können.
Die systematische Einbindung studentischer Multiplikator:innen als Peers eröffnet Potenziale auf mehreren Ebenen: Studierende lernen voneinander, Lehrende erhalten Unterstützung und Hochschulen können Qualifizierungsstrukturen aufbauen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass entsprechende Initiativen keine zeitlich befristeten Einzelprojekte bleiben.
Das Besondere am bayerischen Modell ist außerdem, dass die Projekte skalierbar und adaptierbar angelegt sind. Andere Bundesländer und Hochschulen könnten das Modell aufnehmen und an ihre spezifischen Bedarfe anpassen. Damit wird ein Weg eröffnet, wie aus Pilotprojekten länderübergreifend oder sogar bundesweit tragfähige Strukturen entstehen können. Für eine nachhaltige Verankerung braucht es deshalb eine langfristige finanzielle Förderung sowie strukturelle und strategische Anbindung.
Der AI Act der EU bietet dafür einen klaren politischen Rahmen – nun sind die Hochschulen gefordert, diesen mit Leben zu füllen, im Interesse aller Statusgruppen. Zuletzt sei noch gesagt: Die AI Guide Academy der TUM ist kein allgemeingültiger Blueprint, aber aus unserer Perspektive ein Beispiel dafür, wie Studierende aktiv in die Gestaltung von KI-Kompetenzentwicklung eingebunden werden können. Unser Vorschlag: Das Modell studentischer KI-Multiplikator:innen sollte bundesweit geprüft, angepasst und – wo sinnvoll – in dauerhafte Strukturen überführt werden. KI verändert Lehren und Lernen längst. Hochschulen sollten diesen Wandel aktiv mitgestalten – gemeinsam mit ihren Studierenden.
Forderungen
Wir fordern jetzt:
- AI und Data Literacy als Future Skills verankern
Hochschulen müssen verpflichtende Angebote schaffen, die Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden den Erwerb technischer, ethischer und kommunikativer KI-Kompetenzen ermöglichen. Diese sollen AI Literacy und Data Literacy sowie Reflexion über Deskilling und den Erhalt fachlicher Eigenleistung umfassen. - Breitenwirksame, barrierearme Formate etablieren
Qualifizierungsangebote müssen niedrigschwellig, diversitätssensibel und mehrsprachig gestaltet werden, damit auch Studierenden mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten, Sprachbarrieren und KI-Einsteiger:innen aus nicht-technischen Fächern eine gleichberechtigte Teilhabe und Qualifizierung ermöglicht wird. - Lehrende systematisch qualifizieren – mit Anreizen
Lehrende sollen regelmäßig Fortbildungen zu KI besuchen. Diese müssen die didaktische Integration von KI, rechtliche Fragen (zum Beispiel Prüfungsrecht), ethische Reflexion und Tool-Kompetenz abdecken. Hochschulen müssen hierfür zeitliche, finanzielle und karrierewirksame Anreizstrukturen schaffen. - Peer-Learning-Formate mit studentischen Multiplikator:innen fördern
Der Aufbau von KI-Tutor:innen-Programmen wie der AI Guide Academy soll flächendeckend unterstützt werden. Studierende sollen als Peer-Lernende und Multiplikator:innen aktiv in den Kompetenzaufbau für Studierende und Lehrende eingebunden sein. - Studierende als aktive Gestalter:innen der KI-Qualifizierung einbinden
Curriculum-Entwicklung muss partizipativ gestaltet werden. Studierende sollen mitentwickeln, wie KI in Fächer, Lehrformate und Prüfungen integriert wird, beispielsweise über Beteiligung in Gremien, Arbeitsgruppen und Reflexionsformaten. - Transfer- und Beratungsstellen aufbauen und vernetzen
Wir fordern zentrale Stabsstellen für KI in Studium und Lehre auf Leitungsebene sowie dezentrale KI-Transferstellen in den Fachbereichen mit studentischen KI-Multiplikator:innen als Brückenpersonen.
Wir fordern mittelfristig:
- KI-Kompetenzförderung gesetzlich verankern
Der EU AI Act muss auf Hochschulebene konkretisiert werden und der Erwerb von AI und Data Literacy bundesweit in den Hochschulgesetzen als verbindlicher Bestandteil aller Studiengänge und als strukturelle Aufgabe der Hochschulen verankert werden. - Kultur des kritischen KI-Umgangs entwickeln
Hochschulen sollen nicht nur Technikanwendung vermitteln, sondern eine Kultur des reflektierten, verantwortungsvollen Umgangs mit KI als gemeinsame Aufgabe aller Statusgruppen fördern. - Partizipative Curriculums-Entwicklung institutionalisieren
In allen Fachbereichen sollen Gremien etabliert werden, die die Auswirkungen von KI auf Lehre und Prüfungen reflektieren. Diese Gremien müssen dauerhaft mit Studierenden besetzt sein. - Ein KI-Zertifikat für Studierende schaffen
Wir fordern die Einführung eines modular aufgebauten Zertifikats für KI-Kompetenzen, das Grundlagen und fachspezifische Vertiefung verbindet, beispielsweise mit Anrechnung auf das Grundstudium und Sichtbarkeit im Diploma Supplement/Transkript.
Call to Action
Unsere Position ist kein fertiger Entwurf, sondern ein Beitrag zum Diskurs – offen für Ergänzungen, Kritik und neue Perspektiven. Haltung entsteht im Gespräch, im Widerspruch, in der Praxis. Deshalb laden wir euch ein, mitzudenken, mitzusprechen und mitzugestalten.
Kennst du gelungene Beispiele, wie KI-Kompetenzen an deiner Hochschule vermittelt, diskutiert oder gemeinsam aufgebaut werden? Gibt es Projekte, Workshops, Peer-Formate oder Weiterbildungskonzepte, die besonders inklusiv oder innovativ sind? Dann teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren oder schick uns eine Nachricht.
Wenn du unsere Position teilst, hilf mit, sie sichtbar zu machen: Leite den Beitrag weiter, bring ihn in Diskussionen ein, nimm ihn mit in Gremien oder Teamrunden. Denn Bildung über KI ist nicht nur eine technische, sondern eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe.
Quellen
- KI-Tutoren Bayern: https://ki-tutoren-bayern.de/
- AI Guides Academy: Unterstützung für den KI-Einsatz in der Lehre. Technische Universität München, ProLehre. https://www.prolehre.tum.de/prolehre/angebote/lehrentwicklung/ai-guides/
- Ehlers, U.-D., & Rauch, E. (2024). KI im Studium aus Studierendensicht: Nutzung, Fähigkeiten und Einstellungen Studierender zu KI. Ergebnisse aus Daten der DHBW-Studierenden Panelstudie 2024. NextEducation. https://next-education.org/downloads/2024-11-13_Forschungsbericht_KI-Nutzungsverhalten_Studierender_der_DHBW.pdf
- Hüsch, M., Horstmann, N., & Breiter, A. (2024). CHECK – Künstliche Intelligenz in Studium und Lehre: Die Sicht der Studierenden im Wintersemester 2023/24 (22 Seiten). CHE Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung.
- Hüsch, M., Horstmann, N., & Breiter, A. (2025). DatenCHECK 6/2025: Künstliche Intelligenz im Studium – die Sicht von Studierenden im Wintersemester 2024/25. CHE Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung. https://hochschuldaten.che.de/kuenstliche-intelligenz-im-studium-die-sicht-von-studierenden-im-wintersemester-2024-25/
Autorinnen

Sarah Becker studiert im Master Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum mit einem persönlichen Fokus auf Technikphilosophie und Technikethik, insbesondere mit Schwerpunkt auf Bildungstechnologien und Künstliche Intelligenz. Dort arbeitet sie als studentische Mitarbeiterin in verschiedenen Projekten, berät Lehrende zu digitalen Lehr-Lernkonzepten und veranstaltet Workshops für Studierende zum Thema Künstliche Intelligenz. Sie setzt sich für studentische Partizipation im Diskurs zu generativer KI und für die Vermittlung von KI-Kompetenzen an Studierende ein.

Annalisa Biehl studiert im Master Erziehungswissenschaft an der Universität Münster. Neben ihrem Studium engagiert sich hochschulpolitisch in Fachschaft sowie AStA und arbeitet sie als Hilfskraft an den Universitäten Münster, Bielefeld sowie Konstanz. Im Rahmen dieser Tätigkeiten beschäftigt sie sich vornehmlich mit Fragen von Partizipation, Diversität und Nachhaltigkeit im Kontext von Lehrer:innenbildung und Hochschulforschung.




 Mauritz Danielsson
Mauritz Danielsson 
 Peter van der Hijden
Peter van der Hijden 
