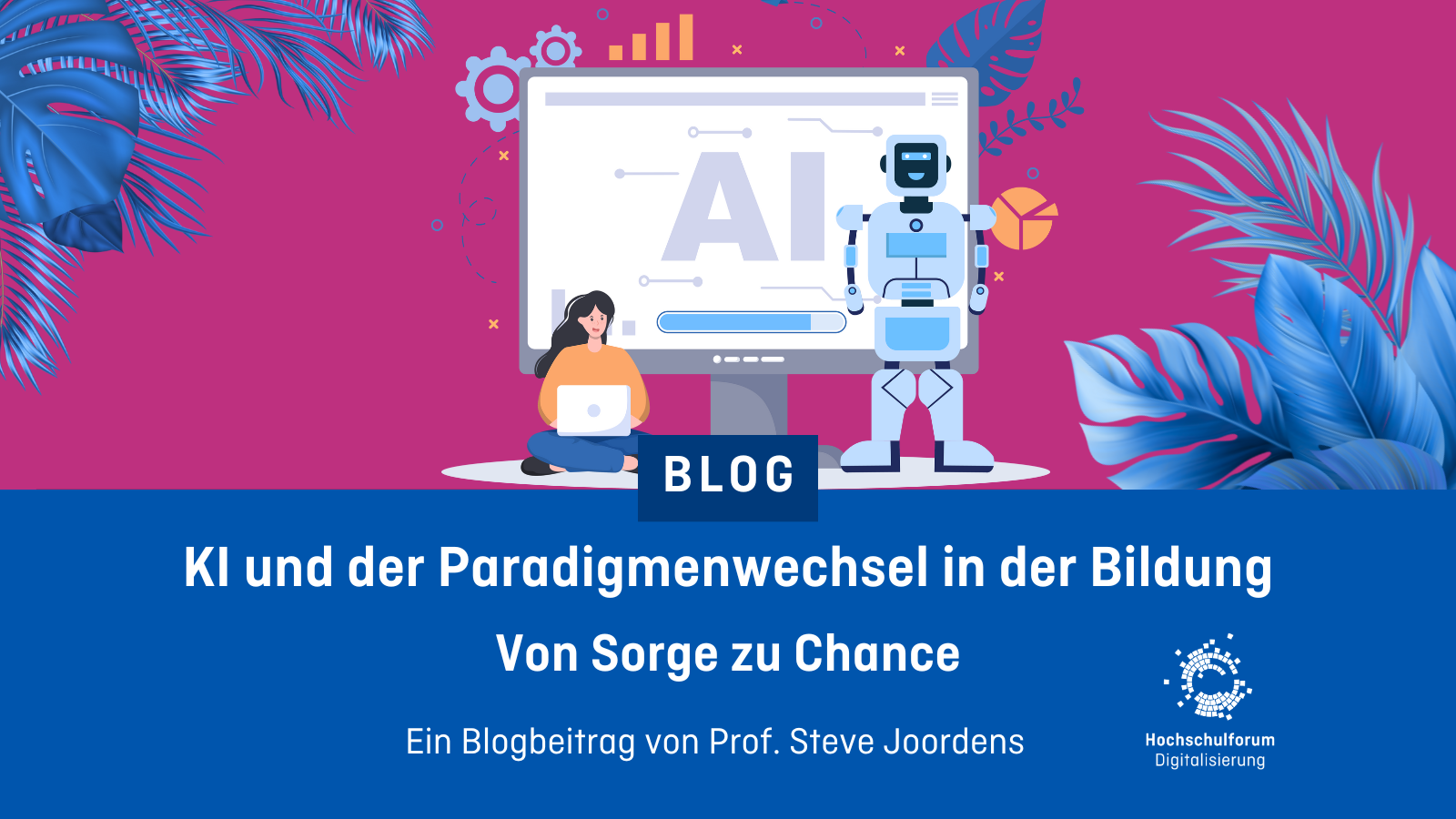Vom Handschlag zu UniDig: Schwedens Weg zu einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur
Vom Handschlag zu UniDig: Schwedens Weg zu einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur
01.10.25
Schwedens Universitäten haben vor kurzem einen Durchbruch erzielt, indem sie sich unter dem Namen „UniDig“ eine Allianz geschaffen haben, die einen neuen Standard für die Zusammenarbeit im Hochschulbereich setzt. Das schwedische Modell, wie auch die deutschen Hochschulen und das HFD die nationalen Herausforderungen meistern können, indem sie zusammenarbeiten, aktiv werden und digitale Dienste gemeinsam nutzen.
Die schwedischen Universitäten haben in Bezug auf die digitale Infrastruktur parallel gearbeitet, wobei es jedoch manchmal zu Doppelungen kam und somit die Gelegenheit verpasst wurde, mit einer stärkeren gemeinsamen Stimme zu sprechen.
Der Verband der schwedischen Hochschuleinrichtungen (SUHF) hat diese Lücke erkannt. In einem Branchenbericht wies der SUHF darauf hin, dass die Digitalisierung zwar schnell voranschreitet, Schwedens E-Infrastruktur im Hochschulbereich aber fragmentiert ist und daher die digitalen Möglichkeiten nicht vollständig genutzt werden.
Als Reaktion darauf gründete die SUHF eine Arbeitsgruppe für digitale Infrastruktur. Die Aufgabe der Gruppe war einfach, aber ehrgeizig: Sie sollte untersuchen, wie Universitäten im Bereich digitaler Transformation effektiver zusammenarbeiten könnten. Ihre Analyse ergab, dass Dialog allein nicht ausreichen würde – ein stärkeres, gemeinsames Engagement war erforderlich.
Der Handschlag: Ein symbolischer, aber machtvoller Schritt
Diese Verpflichtung wurde im Juni 2025 eingegangen, als 38 Universitäten den sogenannten Handshake unterzeichneten(auf Schwedisch hier veröffentlicht).
Der Handschlag war eine Absichtserklärung – kein rechtsverbindlicher Vertrag, sondern ein symbolischer Akt mit echtem strategischem Gewicht. Er verpflichtete die Institutionen zu sechs gemeinsamen Zielen:
- Kontrolle über die eigene digitale Infrastruktur sicherstellen.
- Qualität in Bildung und Forschung sichern.
- Zugang zu einem gemeinsamen Paket von Kerndienstleistungen.
- Benötigte Dinge gemeinsam identifizieren und beschaffen.
- Den Sektor mit einer Stimme in nationalen und internationalen Foren vertreten.
- Ressourcen bei gleichzeitiger Sicherung digitaler Kompetenzen effizient nutzen.
Ebenso wichtig ist, dass der Handshake die Grundsätze der Zusammenarbeit festlegt: Vertrauen, Flexibilität und langfristiges Engagement.
Rückblickend würde ich sagen, dass der Handshake entscheidend war. Er machte aus einer Analyse ein Mandat. Er gab uns den Schwung, den wir brauchten, um den Sprung von der Diskussion ins Handeln zu schaffen.
Zum Start von UniDig
Der nächste Schritt wird der Aufbau einer Struktur sein, die diese Ziele in die Tat umsetzen kann. Am 22. Oktober 2025 werden wir UniDig – kurz für „digitale Infrastruktur der Universitäten“ – offiziell starten.
UniDig wird ein formelles Konsortium sein, das von einer Generalversammlung, in der alle Institutionen vertreten sind, einem Vorstand, der die strategische Führung übernimmt, und einem Sekretariat, das die Umsetzung unterstützt, geleitet wird.
Mit anderen Worten: Der Handshake hat Vertrauen geschaffen, und UniDig wird die Werkzeuge zum Handeln bereitstellen.
Unsere ersten Prioritäten
UniDig wird sich von Anfang an auf Bereiche konzentrieren, in denen die Zusammenarbeit unmittelbare und sichtbare Vorteile bringt:
- Gemeinsame Prozesse zur Identifizierung und Priorisierung digitaler Dienste entwickeln.
- Die Beschaffung von IT-Lizenzen koordinieren, um die Kosten für den gesamten Sektor zu senken.
- Als kollektiver Partner im Dialog mit Regierungsbehörden und privaten Anbietern auftreten.
- Eine gemeinsamene internationale Stimme schaffen, insbesondere bei digitalen Initiativen auf EU-Ebene.
- Gemeinsame Lösungen in Bereichen wie digitale Sicherheit und Innovation erforschen, zum Beispiel durch ein „Innovationslabor.“
Bei diesen Prioritäten geht es nicht nur um Effizienz. Es geht darum, sicherzustellen, dass Schwedens Universitäten ihre eigene digitale Zukunft gestalten können, anstatt sie für sich gestalten zu lassen.
Lektionen aus dem schwedischenen Experiment
Wenn ich auf die Reise bis jetzt zurückblicke, denke ich, dass drei Lektionen auch für Kolleg:innen in anderen nationalen Kontexten von Bedeutung sind:
- Beginnen Sie mit einer Analyse und einem umfassenden Mandat. Der Bericht und die Arbeitsgruppe des SUHF lieferten die Grundlage und die Legitimation.
- Gehen Sie von der symbolischen Absicht zur Struktur über. Ohne UniDig hätte der Handschlag nur Worte auf Papier bleiben können.
- Liefern Sie frühzeitig Ergebnisse. Durch die Konzentration auf Lizenzierung und Beschaffung kann UniDig von Anfang an konkrete Ergebisse präsentieren.
Blick nach vorn
UniDig ist zwar noch in Vorbereitung, aber zeigt schon eine neue Art der Zusammenarbeit im schwedischen Hochschulwesen. Was als SUHF-Bericht, dann als Arbeitsgruppe und schließlich als Handschlag begann, wird nun zu einem voll funktionsfähigen Konsortium mit einem langfristigen Mandat.
Unser Ziel ist es nicht nur, die digitale Infrastruktur in Schweden zu stärken, sondern auch einen Beitrag zur globalen Diskussion darüber zu leisten, wie Universitäten gemeinsam die Herausforderungen der digitalen Transformation meistern können.
Für Länder mit zersplitterten Hochschullandschaften bietet das schwedische Experiment meiner Meinung nach eine hoffnungsvolle Botschaft: Zusammenarbeit ist möglich – wenn man mit Vertrauen beginnt, sich zu gemeinsamen Zielen verpflichtet und Strukturen aufbaut, die Worten Taten folgen lassen.
Reflexionen
von Channa van der Brug (HFD)
Für die politischen Entscheidungsträger:innen in Deutschland macht das schwedische Beispiel deutlich, dass ein koordinierter Ansatz für die digitale Infrastruktur nicht nur eine operative Frage ist, sondern auch eine Frage der nationalen Wettbewerbsfähigkeit in Forschung und Hochschulbildung. Ein gemeinsam verwaltetes Forum oder eine Plattform kann dazu beitragen, die Bedürfnisse des Sektors mit den langfristigen politischen Zielen in Einklang zu bringen und so Effizienzgewinne und eine stärkere internationale Position innerhalb des Europäischen Hochschulraums und der laufenden digitalen Initiativen der EU zu erzielen.
Für Hochschulen und Branchennetzwerke lautet die Lehre aus Schweden, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit die institutionelle Autonomie stärkt, indem sie die Autorität über zentrale digitale Infrastrukturen sichert und kollektive Verhandlungsmacht bietet, anstatt sie zu schmälern. Aufbauend auf den Grundlagen, die das Hochschulforum Digitalisierung bereits geschaffen hat, können die deutschen Hochschulen über den Dialog und die Pilotprojekte hinausgehen und strukturierte, verbindliche Rahmenbedingungen schaffen, die eine dauerhafte digitale Kapazität und Einflussnahme auf nationaler und internationaler Ebene gewährleisten würden.
Autor

Mauritz Danielsson ist CEO des Ladok-Konsortiums, das das nationale Studenteninformationssystem Schwedens entwickelt. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau kollaborativer digitaler Infrastrukturen für den Hochschulbereich und ist derzeit Mitglied einer Arbeitsgruppe, die UniDig, ein neues Konsortium für die digitale Infrastruktur von Universitäten, gründen wird. Er hat sowohl Informatik als auch Englisch an der Technischen Universität Luleå studiert und dort verschiedene Positionen inne gehabt, vom Dozenten bis zum Leiter des Studentenwerks.

 Peter van der Hijden
Peter van der Hijden 
 Annalisa Biehl
Annalisa Biehl 
 Steve Joordens
Steve Joordens