Prüfungsangst digital anpacken: Was wir mit dem StudiCoachBot über KI-basiertes Coaching im Studium gelernt haben
Prüfungsangst digital anpacken: Was wir mit dem StudiCoachBot über KI-basiertes Coaching im Studium gelernt haben
27.11.25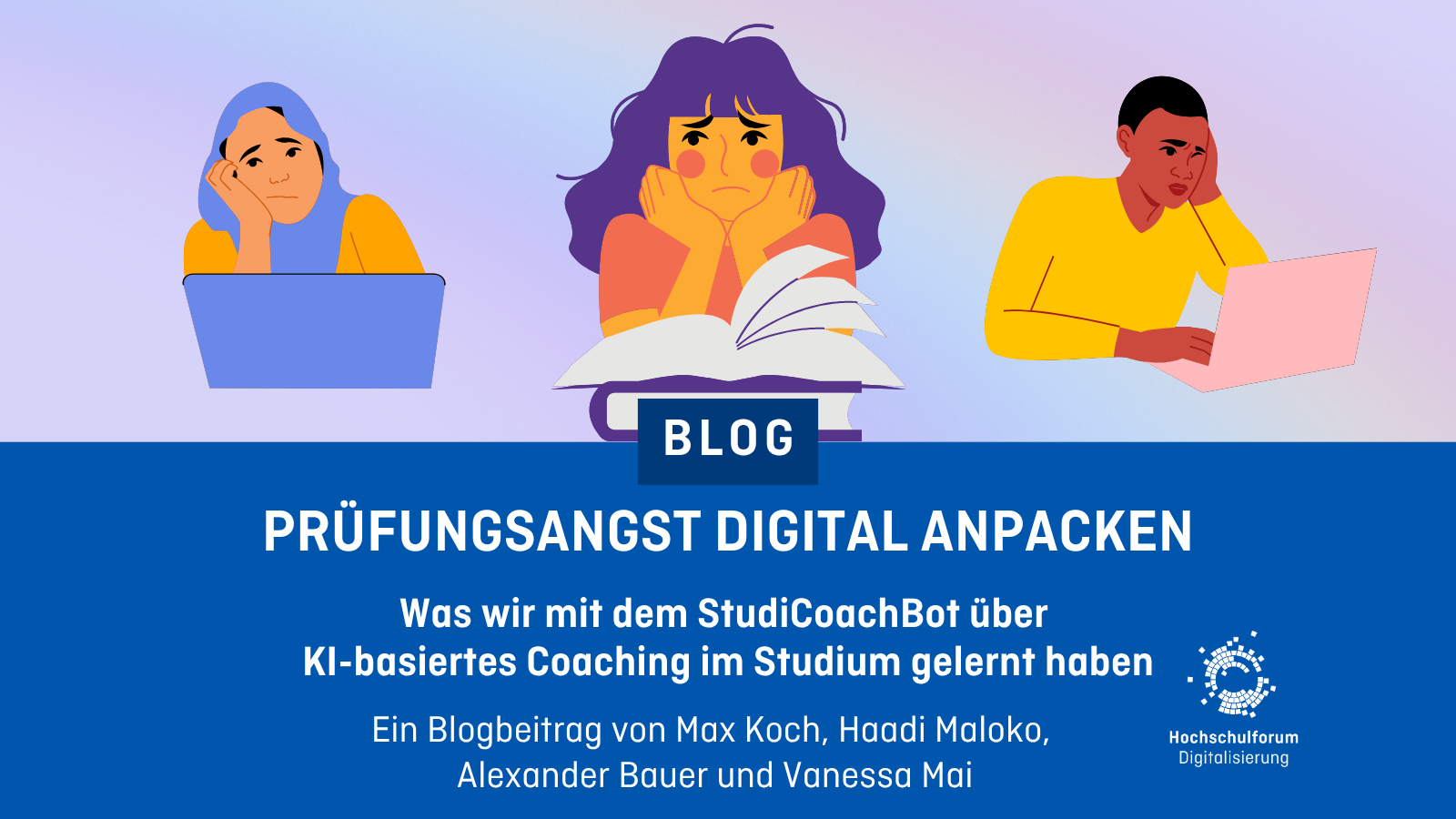
Dieser Blogbeitrag untersucht, wie Prüfungsangst bei Studierenden mithilfe digitaler Mittel begegnet werden kann. Zu diesem Zweck hat die Technische Hochschule Köln einen KI-basierten Chatbot entwickelt, der Studierenden in Prüfungsängsten zur Seite stehen und ihnen Ratschläge geben soll. Wie der Bot genau funktioniert, wie das Projekt begleitet wird und welche Erkenntnisse sich daraus für KI-basiertes Coaching gewinnen lassen, zeigt dieser Artikel.
Wenn Prüfungsangst zur unsichtbaren Studi-Krise wird
Prüfungsangst gehört zu den häufigsten psychischen Belastungen im Studium. Laut einer repräsentativen Umfrage der IU International University of Applied Sciences haben neun von zehn Studierenden bereits darunter gelitten – doch nur 14 Prozent suchten aktiv Unterstützung. Die meisten gaben an, keine passenden Angebote zu finden oder Hemmungen zu haben, über ihre Sorgen zu sprechen (IU 2022). Diese Zahlen zeigen, wie groß die Diskrepanz zwischen erlebtem Bedarf und tatsächlicher Inanspruchnahme professioneller Hilfe ist.
Auch an Hochschulen selbst wird diese Entwicklung spürbar: Psychologische Beratungsstellen berichten von einer stetigen Zunahme stressbedingter Anfragen, besonders rund um Prüfungsphasen. Prüfungsdruck, finanzielle Unsicherheiten und die Nachwirkungen der Pandemie haben die mentale Belastung zusätzlich verschärft (TK-Gesundheitssport 2023) Prüfungsangst ist damit längst kein Randphänomen mehr – sie steht exemplarisch für das größere Thema der psychischen Gesundheit von Studierenden.
Der erste Schritt zählt: Wie ein Chatbot Gespräche über mentale Gesundheit eröffnet
Für viele ist der schwierigste Schritt, überhaupt zuzugeben, dass etwas nicht stimmt. Scham, Unsicherheit und die Angst vor Stigmatisierung führen dazu, dass Betroffene oft zu lange zögern, sich Hilfe zu holen. Genau hier setzen niedrigschwellige, digitale Angebote an: Sie sind jederzeit erreichbar, reagieren ohne Vorbehalte und bieten einen geschützten Raum für Selbstreflexion (Kanatouri 2020).
Mit dem StudiCoachBot haben wir ein solches Angebot geschaffen. Entwickelt an der Technischen Hochschule Köln im Rahmen des hochschulweiten, interdisziplinären Forschungsprojekts „REDiEE – Roll-out, Empowerment, Design in Engineering Education“ und gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, unterstützt der Chatbot Studierende dabei, Prüfungsangst besser zu verstehen. Sie können eigene Bewältigungsstrategien entwickeln – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur persönlichen Beratung. Das Besondere daran: Der Bot ist rund um die Uhr verfügbar, anonym nutzbar und so konzipiert, dass er den Einstieg in die Selbstreflexion erleichtert.
Der StudiCoachBot wurde ursprünglich als KI-Use-Case im Rahmen des HFD-Aufrufs zu innovativen KI-Anwendungen eingereicht. Damit steht er exemplarisch für die Frage, wie künstliche Intelligenz im Hochschulkontext verantwortungsvoll, nutzer:innenzentriert und didaktisch sinnvoll eingesetzt werden kann. In diesem Beitrag greifen wir diesen Use Case erneut auf und zeigen, was wir aus der Entwicklung, Erprobung und Evaluation über KI-basiertes Coaching und mentale Gesundheit im Studium gelernt haben.
Warum wir ihn entwickeln? Weil der erste Schritt oft der schwerste ist. Und weil wir überzeugt sind, dass künstliche Intelligenz, richtig eingesetzt, mehr sein kann als Technologie – nämlich ein Werkzeug, das Barrieren senkt und Gespräche über mentale Gesundheit eröffnet.
Use Case: Der StudiCoachBot
Vom Konzept zum Coach: Wie der StudiCoachBot Studierende stärkt
Der StudiCoachBot wurde an der TH Köln (von 2021-2015) als digitales Selbst-Coaching-Tool entwickelt, das Studierende dabei unterstützt, eigene Strategien im Umgang mit Prüfungsangst zu finden. Ziel ist nicht therapeutische Behandlung, sondern die Förderung von Selbstreflexion und lösungsorientiertem Denken – als niedrigschwellige Ergänzung zur persönlichen Beratung. Im Dialog mit dem Bot können Nutzer:innen Belastungen sortieren, Auslöser erkennen, Ressourcen aktivieren und konkrete nächste Schritte planen.
Vom Defizit zur Ressource: Systemisches Denken im digitalen Coaching
Der StudiCoachBot orientiert sich am Ansatz des systemischen Coachings, der den Blick auf Lösungen und Ressourcen richtet statt auf Defizite. Er stellt offene, reflektierende Fragen, paraphrasiert Antworten und fasst sie in eigenen Worten zusammen. Dieses Vorgehen schafft Struktur und vermittelt das Gefühl, verstanden zu werden. Unsere Studien zeigen, dass solche dialogischen Selbst-Coaching-Formate Hemmschwellen senken, insbesondere bei sensiblen Themen wie Prüfungsangst. So kann KI-Coaching als niedrigschwelliger Reflexionsraum wirken, in dem Studierende sich ohne Wertung mit ihren Ängsten auseinandersetzen (Mai 2024).
Zwischen Regelwerk und Gefühl: Die Architektur des StudiCoachBot
Technisch beruht der Bot auf einer hybriden Architektur: Regelbasierte Komponenten sichern Gesprächsführung, Datenschutz und inhaltliche Leitplanken, während generative Sprachmodelle dort eingesetzt werden, wo eine natürlichere Sprache Mehrwert schafft – etwa beim Paraphrasieren, bei Anschlussfragen oder beim Ausdruck von Empathie. So entsteht eine Balance aus Verlässlichkeit und sprachlicher Flexibilität. Alle Eingaben werden anonymisiert, bevor sie zu Forschungszwecken ausgewertet werden; personenbezogene Daten werden nicht erhoben.
Transparenz schafft Vertrauen: Onboarding als Schlüssel zur AI Literacy
Ein zentraler Bestandteil des Designs ist das Onboarding. Zu Beginn erklärt der StudiCoachBot transparent, was er leisten kann – und was nicht. Er macht deutlich, dass er ressourcenorientiert arbeitet, beim Sortieren der Situation unterstützt und Stärken hervorhebt, ohne therapeutische Beratung zu ersetzen. Bei Krisen verweist er konsequent auf professionelle Hilfsangebote. Diese Rollenklärung stärkt das Vertrauen und fördert AI Literacy – also das Verständnis dafür, was KI leisten kann und wo ihre Grenzen liegen (Mai & Richert in press).
Interdisziplinär denken, gemeinsam entwickeln
Entwickelt wird der StudiCoachBot in einem interdisziplinären Team aus Studierenden und Forschenden der Psychologie, Kommunikationswissenschaft, Informatik und des Maschinenbaus. Im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten sowie einer Dissertation verbinden wir Forschung, Lehre und Praxis und ermöglichen es so, Studierende aktiv in Konzeption, Test und Evaluation einzubinden – ein wichtiger Aspekt, um Sprache, Tonalität und Bedürfnisse realistisch abzubilden.
Doch wie wirksam ist ein solches System wirklich und was lässt sich aus den Gesprächen lernen?
Erfahrungen und Evaluation
Vom Prototyp zum Partner: Der iterative Weg des StudiCoachBot
Seit 2021 wird der StudiCoachBot an der TH Köln iterativ weiterentwickelt – in einem Forschungsansatz, der auf Design-Based Research basiert. Jede Entwicklungsrunde umfasst Konzeption, Prototyping, Erprobung und datenbasierte Verbesserung. Ziel ist, nicht nur die technische Qualität zu steigern, sondern auch das Zusammenspiel von Conversation Design – also der Dialoggestaltung –, Beziehung und Wirksamkeit systematisch zu verstehen (Mai 2024).
Digitale Beziehungsgestaltung: Drei Strategien, die Nähe schaffen
Im Mittelpunkt der Begleitforschung steht die Frage, wie digitale Beziehungsgestaltung gelingen kann. Drei Gesprächsstrategien wurden bereits in verschiedenen Studien erprobt und im Rahmen einer Bachelor-, vier Masterarbeiten und einer Dissertation veröffentlicht:
- Selbstoffenbarung (Self-Disclosure): Der Chatbot teilt gezielt kurze, kontextbezogene Einblicke in die eigene „Perspektive“. Dadurch entsteht Nähe und Normalisierung – etwa in Aussagen wie: „Weißt du, manchmal merkt man mir an, wenn ich nervös bin – zum Beispiel vor Updates. Wie ist das bei dir: Merken andere, wenn du vor Prüfungen angespannt bist?“ Diese Form der Selbstoffenbarung senkt nachweislich die Distanz und steigert die erlebte soziale Präsenz (Mai et al. 2021, Mai et al. 2023).
- Sprachliche Empathie: Der StudiCoachBot reagiert mit wertschätzenden und präzisen Rückmeldungen auf das, was Studierende teilen. Das Ziel ist, Resonanz zu erzeugen und Verständnis sprachlich spürbar zu machen.
- Paraphrasieren mit generativer KI: Hier werden Large Language Models (LLM) eingesetzt, um Aussagen flexibel und natürlich in eigenen Worten zusammenzufassen. Das Paraphrasieren dient der kognitiven Strukturierung und stärkt das Gefühl, verstanden zu werden (Bauer et al. in press).
Zentrale Erkenntnisse: Wenn Conversation Design Vertrauen aufbaut
Die Ergebnisse der Begleitforschung zeigen: Selbstoffenbarung und Empathie erhöhen die wahrgenommene soziale Präsenz, während präzises Paraphrasieren den Rapport und damit die Qualität der Arbeitsbeziehung stärkt (Mai 2024). Über mehrere Entwicklungszyklen hinweg nahm insbesondere die emotionale Bindung zwischen Nutzer:innen und Bot deutlich zu.
Ergänzend werden in unserer Forschung psycho-physiologische Verfahren eingesetzt, um emotionale und kognitive Reaktionen objektiv zu erfassen – etwa durch die elektrodermale Aktivität (EDA) als Maß für emotionale Erregung oder durch die Herzfrequenzvariabilität (HRV) zur Einschätzung mentaler Belastung (Mai et al. 2024). Diese explorativen Analysen liefern wertvolle Einblicke in unbewusste Prozesse und ergänzen die subjektiven Rückmeldungen der Studierenden.
Fazit und Transferpotenzial
Zwischen Menschlichkeit und Maschine: Was KI leisten kann
Die Entwicklung und Erforschung des StudiCoachBot zeigt: Beziehung zählt – auch im Digitalen. Selbstoffenbarung, Empathie und Paraphrasieren sind keine Stilfragen, sondern zentrale Wirkfaktoren gelingender Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Sie fördern Nähe und Vertrauen – selbst dann, wenn das Gegenüber kein Mensch, sondern ein KI-gestützter Coach ist (Mai 2024).
Ebenso wurde deutlich, dass hybride Architekturen entscheidend für Qualität und Sicherheit sind. Regelbasierte Komponenten sichern Verlässlichkeit und Datenschutz, während generative Sprachmodelle Natürlichkeit und Situationssensibilität im Dialog stärken. Dieses Zusammenspiel ermöglicht Coaching-Erlebnisse, die konsistent, flexibel und zugleich menschennah wirken (Mai & Richert in press).
Wirkungsvolles Coaching entsteht jedoch nicht allein durch Technik, sondern durch sorgfältiges Conversation Design – durch Sprache, Persona und Struktur. Ein transparentes Onboarding, eine konsistente Tonalität und gezieltes Prompting schaffen Vertrauen und Akzeptanz.
Darüber hinaus verdeutlicht unsere Begleitforschung, dass AI Literacy eine zentrale Voraussetzung ist. Studierende und Lehrende müssen verstehen, was KI leisten kann, wo ihre Grenzen liegen und wann menschliche Unterstützung notwendig bleibt. Der StudiCoachBot ersetzt keine psychologische Beratung, sondern versteht sich als niedrigschwellige Ergänzung, die den Zugang zu Hilfe erleichtert.
Drei Lehren für Hochschulen – und ein Ausblick
Für die Hochschulpraxis lassen sich daraus drei Lehren ziehen: Erstens sollten KI-gestützte Coaching-Tools von Beginn an gemeinsam mit Studierenden gestaltet werden, um Sprache und Bedürfnisse realistisch abzubilden. Zweitens braucht Vertrauen in digitale Systeme die Verbindung aus technischer Robustheit und menschlicher Gestaltungskompetenz. Und drittens zeigt der StudiCoachBot, wie Hochschulen Mental-Health-Themen sensibel und innovativ aufgreifen können – ohne therapeutische Aufgaben zu übernehmen.
Die zentrale Erkenntnis bleibt: Gute KI in der Hochschulbildung entsteht nur gemeinsam. Wenn Technik, Sprache und Ethik ineinandergreifen, kann KI dazu beitragen, Barrieren zu senken, Selbstreflexion zu fördern und mentale Gesundheit im Studium nachhaltig zu stärken.
Autor:innen

Alexander Bauer ist Senior Developer im Projekt StudiCoachBot des TH-weiten Forschungsprojekts REDiEE – Roll-out, Empowerment, Design in Engineering Education (gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre). Er leitet die Konzeption, technische Entwicklung und Evaluation des StudiCoachBots.

Maximilian Koch ist Mitwirkender am StudiCoachBot-Projekt im Rahmen des TH-weiten Forschungsprojekts REDiEE – Roll-out, Empowerment, Design in Engineering Education (gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre). Er unterstützt die Konzeption, technische Entwicklung und Evaluation des StudiCoachBots.

Dr. rer. nat. Vanessa Mai ist Leiterin der Forschungsgruppe „Smart Technologies in Coaching & Learning” am Cologne Cobots Lab und Vorstandsmitglied des Zentrums für Lehrentwicklung an der TH Köln. Als systemische Coach und Supervisorin (DGSv-zertifiziert) forscht und lehrt sie im Bereich KI-basiertes Coaching. In ihrer Dissertation „Chatbots im (Studierenden-)Coaching“ untersuchte sie beziehungsbildende Faktoren im KI-basierten Mensch-Maschine-Coaching.

Haadi Maloko ist Mitwirkender am StudiCoachBot-Projekt im Rahmen des TH-weiten Forschungsprojekts REDiEE – Roll-out, Empowerment, Design in Engineering Education (gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre). Er unterstützt die Konzeption, technische Entwicklung und Evaluation des StudiCoachBots.

 Mauritz Danielsson
Mauritz Danielsson 
 Peter van der Hijden
Peter van der Hijden 
 Annalisa Biehl
Annalisa Biehl 