Inferenz ist nicht alles: Der Trugschluss zentralistischer KI-Modelle an Hochschulen?
Inferenz ist nicht alles: Der Trugschluss zentralistischer KI-Modelle an Hochschulen?
02.10.25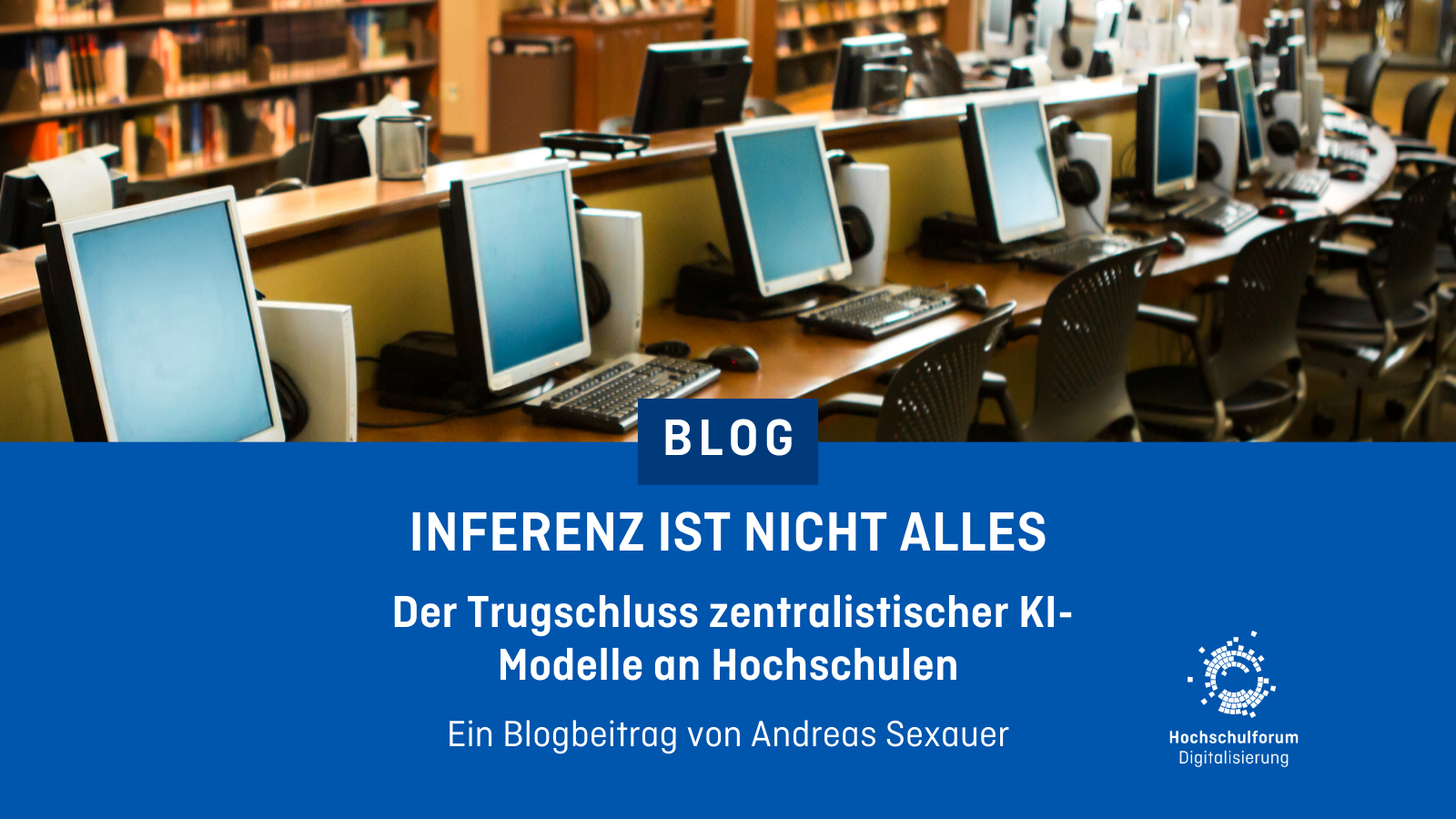
Die Frage nach souveränen KI-Infrastrukturen an Hochschulen steht aktuell im Zentrum vieler Debatten – zwischen dem Ruf nach zentralen Lösungen und der Sorge um Innovationskraft und Vielfalt. In seinem Meinungsbeitrag argumentiert Andreas Sexauer dafür, dass zentralistische Modelle in eine strategische Sackgasse führen und plädiert stattdessen für ein föderiertes Ökosystem, das auf Vielfalt, Wettbewerb und Kooperation setzt.
Die berühmte Publikation „Attention Is All You Need“ (Vaswani et al., 2017) hat eine Ära der dezentralen Innovation im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingeläutet. Acht Jahre später scheint sich in der deutschen Hochschullandschaft eine gegenläufige Logik zu verfestigen, die sich in einem unausgesprochenen Mantra zusammenfassen lässt: „Inference is all you need.“ Die strategische Debatte um KI wird dominiert von der Forderung nach eigener Inferenz-Rechenleistung und digitaler Souveränität. Doch die Lösungsansätze, die daraus abgeleitet werden, drohen genau das zu zerstören, was sie zu schützen vorgeben: unsere Innovationskraft und geistige Vielfalt.
Digitale Souveränität, wie eine Expertenanhörung des Hochschulforums Digitalisierung betonte (Hochschulforum Digitalisierung, 2023), ist mehr als nur technische Unabhängigkeit von US-Hyperscalern. Da KI-Modelle „weltanschaulich nicht neutral“ sind, geht es um die Fähigkeit, eine Vielfalt an Werkzeugen, Modellen und Methoden kritisch zu bewerten und souverän einzusetzen. Der aktuelle Trend hin zu zentralistischen Versorgungsmodellen und nationalen Insel-Lösungen ist das genaue Gegenteil davon: Er führt in eine Monokultur, die Exzellenz durch Konformität ersetzt.
Basierend auf den neuesten Erkenntnissen des KI-Monitors 2025 des Hochschulforums Digitalisierung (HFD) (Budde & Tobor, 2025) möchte ich in diesem Artikel argumentieren, warum der Ruf nach einem zentralen KI-Anbieter für alle Hochschulen ein strategischer Irrweg ist. Gleichzeitig werde ich aufzeigen, warum auch die gut gemeinte Entwicklung nationaler oder regionaler KI-Plattformen eine Fehlinvestition von Ressourcen darstellt. Stattdessen plädiere ich für ein mutiges Bekenntnis zum Föderalismus: ein Ökosystem des Wettbewerbs und der Kooperation, in dem Hochschulen ihre Energie auf die eigentliche Wertschöpfung konzentrieren, anstatt die Fehler zentralistischer Planwirtschaft im Zeitalter der KI zu wiederholen.
Der Status Quo: Defensive Risikoverwaltung als Nährboden für den Zentralismus
Ein Blick in den neuen KI-Monitor 2025 des HFD (Budde & Friedrich, 2024) bestätigt, was viele in der Praxis spüren: Die Hochschulen befinden sich in einem reaktiven, fast ängstlichen Modus. Die meistdiskutierten Themen sind die Implikationen von KI auf Prüfungen (97 %), die Auswirkungen auf die akademische Integrität (90 %) und der Datenschutz (88 %). Diese defensive, risikoorientierte Haltung ist empirisch belegt und hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar noch deutlich verstärkt.
Diese Fokussierung ist verständlich. Die Geschwindigkeit der Entwicklung erzeugt Unsicherheit, und der natürliche administrative Reflex darauf ist der Wunsch nach Kontrolle, Standardisierung und Absicherung. Wenn die primäre Sorge die Einhaltung von Prüfungsordnungen und Datenschutzrichtlinien ist, erscheint eine einfache, zentral verwaltete Lösung als der sicherste Hafen. Nur 15 % der Hochschulen haben bereits eine explizite KI-Strategie, während 50 % eine solche erarbeiten – oft unter dem Druck, schnell eine kontrollierbare Antwort auf das vermeintliche Chaos zu finden.
Genau aus dieser defensiven Grundhaltung erwächst die Anziehungskraft zentralistischer Modelle. Der Ruf nach einem einzigen Anbieter, der eine datenschutzkonforme, kostengünstige und standardisierte KI-Grundversorgung für alle liefert, ist die logische Konsequenz einer Strategie, die primär auf Risikominimierung statt auf Innovationsmaximierung ausgerichtet ist. Es ist der Versuch, die Komplexität einer technologischen Revolution durch administrative Vereinfachung zu bändigen. Doch dieser Weg ist eine strategische Sackgasse, die langfristig weit mehr schadet, als sie kurzfristig nützt. Er opfert die dynamische, unordentliche, aber letztlich produktive Kraft des Wettbewerbs und der Vielfalt der bürokratischen Bequemlichkeit.
Strategischer Irrweg 1: Der Sirenengesang der zentralen Inferenz
Das Angebot, wie es beispielsweise von der GWDG skizziert wird – eine „flächendeckende KI-Grundversorgung“ für Hunderte von Institutionen zu einem vermeintlich günstigen Preis – klingt für Hochschulleitungen und Ministerien wie die Erfüllung aller Wünsche. Es verspricht eine einfache, skalierbare und scheinbar souveräne Lösung. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt es sich als ein Modell, das die Kernprinzipien wissenschaftlicher Forschung und Lehre untergräbt: Vielfalt, Wettbewerb und Autonomie.
Stellen wir uns vor, die DFG würde nur noch Forschungsprojekte fördern, die mit den Instrumenten eines einzigen, zentral bestimmten Herstellers durchgeführt werden. Oder der Bund würde beschließen, dass alle deutschen Automobil-Ingenieure nur noch an einem Einheits-Elektromotor forschen dürfen. Die Absurdität ist offensichtlich. Doch genau in diese Richtung steuern wir mit der Idee eines monolithischen Inferenz-Anbieters. Die Gefahren eines solchen Ansatzes sind fundamental:
- Er schafft eine Monokultur der Modelle: Die KI-Landschaft ist explosionsartig diversifiziert. Neben den großen kommerziellen Modellen gibt es eine Vielzahl von hochspezialisierten, quelloffenen Alternativen – optimiert für Medizin, Recht, spezifische Sprachen oder Programmiercode. Wissenschaftlicher Fortschritt entsteht oft durch den Einsatz genau dieser Nischenmodelle. Ein zentraler Anbieter wird zwangsläufig auf wenige, administrierbare Standardmodelle setzen und so den innovativen „long tail“ der KI-Forschung abschneiden.
- Er bremst die methodische Innovation: Die eigentliche Kunst liegt nicht nur in der Wahl des Modells, sondern in seiner Anwendung: im Fine-Tuning, in neuartigen Prompting-Techniken (Chain of Thought, Tree of Thoughts), in der Kombination verschiedener Modelle zu komplexen Workflows. Forschergruppen müssen die Freiheit haben, autonom und agil zu experimentieren. Ein zentraler Anbieter wird zum Gatekeeper und Flaschenhals, der diese Agilität durch Standardisierung und Bürokratie ersetzt.
- Er führt zum Verlust von Kernkompetenz: Wenn Hochschulen das Betreiben von KI-Modellen – eine Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts – vollständig auslagern, verlieren sie das entscheidende Know-how. Sie werden zu reinen Anwendern einer Blackbox, unfähig, die Technologie kritisch zu bewerten, weiterzuentwickeln oder ihre Studierenden an der technologischen Front auszubilden.
- Er ist strategisch kurzsichtig: Die nächste Stufe, Agentic AI, erfordert den autonomen Zugriff von KI-Systemen auf unzählige, dezentrale Datenquellen und lokale Systeme. Ein zentralistisches Modell ist mit dieser Komplexität unvereinbar. Es zementiert den Status quo, anstatt die Zukunft zu ermöglichen.
Strategischer Irrweg 2: Die Illusion der Souveränität in nationalen Insel-Lösungen
Der zweite, subtilere Irrweg ist die Entwicklung eigener, nationaler oder regionaler KI-Plattformen. Initiativen wie KI:connect.nrw oder das Open-Source-Projekt HAWKI sind aus einem lobenswerten Geist der Kooperation und des Pragmatismus entstanden. Sie lösen ein akutes Problem: den schnellen, datenschutzkonformen Zugang zu KI-Modellen für viele Hochschulen. Sie sind ein Beweis für die hohe Kompetenz und den Gestaltungswillen in der Hochschullandschaft.
Doch bei aller Anerkennung für diese Leistungen müssen wir die strategische Weichenstellung dahinter kritisch hinterfragen. Diese Projekte laufen Gefahr, knappe Ressourcen in den Nachbau von Basistechnologie zu investieren, anstatt auf den Schultern von Giganten zu stehen. Die Entwicklung und Pflege von Nutzeroberflächen und Infrastruktur für KI ist ein globales Wettrennen, das von großen internationalen Open-Source-Communitys und Unternehmen mit Milliarden-Budgets vorangetrieben wird.
Der Versuch, hier eine eigene, nationale Lösung parallel zu etablieren, führt zu drei Problemen:
- Ressourcen-Fehlallokation: Jede Stunde und jeder Euro, die in die Entwicklung einer eigenen Benutzeroberfläche fließen, fehlen bei der eigentlichen Wertschöpfung: bei der Integration von KI in die Lehre, beim Aufbau von RAG-Systemen mit hochschulspezifischem Wissen oder bei der Entwicklung autonomer Agenten für Forschung und Verwaltung. Wir investieren in das Fundament, während andere bereits die Wolkenkratzer darauf bauen.
- Verlust der Anschlussfähigkeit: Eine nationale Insellösung wird sich zwangsläufig von den globalen De-facto-Standards entfernen. Dies führt zu Inkompatibilitäten und erschwert in Zukunft die Adaption neuer, international entwickelter Werkzeuge und Methoden. Wir schaffen uns einen eigenen, proprietären Standard, der uns vom globalen Innovationsgeschehen abkoppelt.
- Fragmentierung statt Bündelung: Anstatt die Kräfte der deutschen Hochschulen in die Beteiligung an einem führenden globalen Open-Source-Projekt zu bündeln und es für unsere Bedürfnisse zu prägen, zersplittern wir sie auf diverse, parallellaufende Eigenentwicklungen.
Die strategisch klügere Wahl ist es, die besten verfügbaren globalen Open-Source-Werkzeuge zu nutzen und die eigene Kraft auf die spezifische, wertschöpfende Anwendung zu konzentrieren.
Das Leitbild: Ein föderiertes Ökosystem des Wettbewerbs und der Kooperation
Niemand käme auf die Idee, die strategische Vielfalt und den Innovationsmotor der deutschen Hochschullandschaft durch eine komplette Zentralisierung der IT auszubremsen. Die Autonomie der Hochschulen und der Wettbewerb der Ideen sind die Grundlage unserer wissenschaftlichen Exzellenz. Genau dieser Grundsatz muss auch für unsere KI-Strategie gelten.
Die Alternative zu Monopol und Isolation ist ein föderiertes, verteiltes KI-Ökosystem. Dieses Modell spiegelt die erfolgreiche Struktur unseres Wissenschaftssystems wider und basiert auf zwei Säulen:
- Intelligente Kooperation bei der Basisinfrastruktur: Der Zugang zu teuren Ressourcen wie Rechenzentren oder der gemeinsame, strategische Einkauf von Lizenzen für Basismodelle kann und sollte in Verbünden (wie dem DFN oder landesweiten Konsortien) organisiert werden. Die entscheidende Rolle dieser Verbünde ist jedoch nicht die des monopolistischen Anbieters, sondern die eines Enablers und Brokers. Sie verhandeln Rahmenverträge und schaffen die technischen Voraussetzungen, damit ihre Mitglieder einfachen Zugang zu einem breiten, globalen Portfolio an Optionen erhalten.
- Gezielter Wettbewerb bei den Services und Methoden: Auf dieser Basis muss ein echter Wettbewerb entstehen. Anstatt eines Anbieters sollten wir eine Landschaft fördern, in der mehrere Hochschulen oder Hochschulverbünde KI-Services anbieten. Eine Universität könnte sich auf die Bereitstellung optimierter Open-Source-Modelle für die Geisteswissenschaften spezialisieren, eine andere auf High-Performance-Computing für die Ingenieurwissenschaften, eine dritte auf besonders sichere Umgebungen für sensible medizinische Daten. Die Nutzer – Forschende, Lehrende und Studierende – können und sollen wählen, welcher Service für ihre spezifische Anforderung der Beste ist. Dieser Wettbewerb ist der stärkste Motor für Qualität, Kosteneffizienz und Innovation.
Dieses Modell schafft Souveränität nicht durch Abschottung, sondern durch Kompetenz und Wahlfreiheit. Es ist die einzige Strategie, die der Dynamik und Vielfalt des KI-Zeitalters gerecht wird.
- Die Anwendungsschicht – RAG-Systeme als Service: Die besondere Stärke der Hochschulen ist ihr kuratiertes Wissen in Bibliotheken, Forschungsdaten-Repositorien und Lehrunterlagen. Die zentrale IT sollte einen RAG-Service auf Basis etablierter internationaler Frameworks betreiben. Die eigentliche Arbeit – die Kuration der Daten und die inhaltliche Anbindung – muss in den Fachbereichen und zentralen Einrichtungen wie den Bibliotheken geleistet werden.
- Die Integrationsschicht – Schnittstellen zu Hochschulsystemen: Der wahre Mehrwert entsteht, wenn KI-Funktionen über APIs tief in die bestehenden Systeme integriert werden – in Lernmanagementsysteme (z.B. für personalisiertes Feedback), in Forschungsinformationssysteme (für die automatisierte Literaturanalyse) oder in die Verwaltung (zur Prozessautomatisierung).
- Die Governance-Schicht – Accounting und Monitoring: Wer nutzt welche Modelle wie intensiv? Was kostet das? Die Entwicklung robuster Systeme zur Verbrauchsmessung, Abrechnung und zum Monitoring ist eine komplexe, aber unabdingbare Kernaufgabe, die Hochschulen selbst lösen müssen, um den Einsatz von KI strategisch steuern zu können.
- Die Innovationsschicht – Agentic AI ermöglichen: Die Zukunft hat bereits begonnen, wie erste Beispiele zeigen: An der IU Internationale Hochschule interagieren Studierende bereits über zwei Millionen Mal monatlich mit dem KI-Tutor „Syntea“ (IU Internationale Hochschule, 2024). Gleichzeitig entwickelt die Universität Stuttgart hochspezialisierte „KI-Ingenieure“, die selbstständig komplexe Simulationen in der Strömungsmechanik durchführen können (Universität Stuttgart, 2024). Diese Beispiele belegen eindrücklich, dass die eigentliche KI-Revolution im dezentralen, fachspezifischen Kontext stattfindet. Dafür müssen Hochschulen die Infrastruktur und die offenen Schnittstellen bereitstellen, damit Fachbereiche solche Agenten für ihre spezifischen Bedürfnisse entwickeln und auf lokale, proprietäre Ressourcen zugreifen lassen können.
Der menschliche Faktor: Mehr als nur Tool-Schulungen
Ein föderiertes Technologie-Modell bleibt eine leere Hülle, wenn es nicht von einer ebenso ambitionierten Qualifizierungsstrategie getragen wird. Der KI-Monitor zeigt, dass 96 % der Hochschulen Workshops für Lehrende anbieten. Das ist ein wichtiger erster Schritt, aber er greift oft zu kurz.
Die Herausforderung besteht darin, von oberflächlichen Tool-Schulungen („Wie schreibe ich einen Prompt?“) zu einer tiefgreifenden „AI Literacy“ für alle Hochschulangehörigen zu kommen. Dies umfasst:
- Für Lehrende: Die Befähigung, die eigene Didaktik fundamental neu auszurichten. Im Zentrum steht ein Paradigmenwechsel bei Prüfungen: Anstatt sie als abzusichernde Festung gegen KI zu betrachten, müssen sie zu einem Ort werden, an dem KI-Kompetenz sichtbar und bewertbar wird. Es geht darum, Aufgaben zu konzipieren, die den intelligenten Einsatz von KI nicht nur erlauben, sondern erfordern, und dabei den kritischen Umgang mit den Ergebnissen in den Mittelpunkt der Bewertung stellen. Voraussetzung dafür ist die persönliche Befähigung der Lehrenden, diese Kompetenzen selbst souverän in der eigenen Lehre vermitteln zu können. Parallel dazu muss KI genutzt werden, um Lehre interaktiver und personalisierter zu gestalten.
- Für Forschende: Die Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit spezialisierten Modellen, im Fine-Tuning und in der Entwicklung von KI-gestützten Forschungs-Workflows. Dies geht weit über die Nutzung eines Allzweck-Chatbots hinaus.
- Für die Verwaltung: Systematische Schulungen zur Identifikation und Umsetzung von Automatisierungspotenzialen in administrativen Prozessen.
- Für Studierende: Die feste Verankerung von KI-Kompetenzen in den Curricula aller Fächer. Es reicht nicht, das Thema in einem einzelnen Seminar zu behandeln. Studierende müssen lernen, KI als selbstverständliches, aber kritisch zu hinterfragendes Werkzeug in ihrem Fachgebiet zu nutzen.
Diese Form der Qualifizierung ist keine einmalige Maßnahme, sondern ein permanenter Prozess des gemeinsamen Lernens, der eine offene Kultur des Experimentierens und des Austauschs erfordert. Es ist wichtig, dass Prozesswissen und die didaktische Kompetenz für Lehr-Lernszeanarien weiter vor Ort in den Hochschulen angesiedelt bleibt und ausgebaut wird. Dies bietet gleichzeitig genügend Raum für kooperative Synergien, wie das gemeinsam entwickelte Schulungsmodul „Verstehen und Anwenden von generativer Künstlicher Intelligenz (KI)“ (HND-BW, 2025) der baden-württembergischen Universitäten zur gemeinsamen Definition der Vermittlung eines ausreichenden Maßes an KI-Kompetenz ihrer Angehörigen, demonstriert.
Der blinde Fleck: Die systematische Ignoranz der studentischen Perspektive
Bei all den Diskussionen um Infrastruktur, Governance und Didaktik offenbart der KI-Monitor 2025 eine eklatante und strategisch 9gefährliche Lücke. Er stellt fest: Viele Studierende nutzen KI zwar selbstverständlich im Studienalltag, ihre Erfahrungen fließen jedoch selten in Entscheidungsprozesse ein. An den befragten Universitäten, so der Monitor, sind Studierende an der strategischen Entwicklung sogar überhaupt nicht beteiligt, bei den befragten HAW nur bei 10%.
Diese systematische Ignoranz der wichtigsten Nutzergruppe ist nicht nur ein Versäumnis in Sachen Partizipation, sondern ein strategischer Fehler erster Ordnung. Wir riskieren, Systeme und Regelungen zu entwerfen, die an der Lebensrealität der Studierenden vorbeigehen. Die Konsequenzen sind absehbar:
- Geringe Akzeptanz und Nutzung: Services, die nicht auf die tatsächlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, werden nicht genutzt.
- Explosion der Schatten-IT: Wenn die offiziellen Angebote unpraktikabel oder unzureichend sind, weichen Studierende (und Personal der Hochschulen) auf unkontrollierte, kommerzielle Tools aus – mit allen damit verbundenen Risiken für Datenschutz und akademische Integrität.
- Verpasste Innovationspotenziale: Studierende sind nicht nur Nutzer, sondern auch kreative Mitgestalter. Sie zu ignorieren bedeutet, auf ihre Ideen, ihre Kritik und ihre Innovationskraft zu verzichten. Wir könnten Studierende als Co-Entwickler für Lern-Agenten einbinden, ihre Erfahrungen für die Verbesserung von RAG-Systemen nutzen oder sie bei der Entwicklung ethischer Leitlinien beteiligen.
Eine KI-Transformation, von oben herab, ist zum Scheitern verurteilt. Sie muss ein partizipativer Prozess sein, der die Expertise und die Erfahrungen aller Statusgruppen ernst nimmt.
Die rechtliche Dimension: Warum der AI Act den Föderalismus stärkt
Die strategische Debatte wird zusätzlich durch eine neue rechtliche Realität geprägt: den EU AI Act. Dieses Gesetz wird verbindliche Compliance-Anforderungen für den Einsatz von KI-Systemen schaffen, insbesondere in als hochriskant eingestuften Bereichen wie der Zulassung zu Studiengängen oder der Bewertung von Prüfungen.
Diese Entwicklung hat Implikationen für unsere Infrastruktur-Debatte. Ein zentralistischer Anbieter, der KI-Services für Hunderte von Hochschulen bereitstellt, würde zu einem Single Point of Failure – nicht nur technisch, sondern auch juristisch. Die Komplexität, die Einhaltung des AI Acts für verschiedene Anwendungsfälle an Hunderten von Hochschulen zu gewährleisten und die damit verbundene Haftung zu tragen, wäre immens.
Ein dezentrales, föderiertes Modell ist hier klar im Vorteil. Es verteilt die Verantwortung und ermöglicht es den einzelnen Hochschulen, Compliance-Fragen in ihrem spezifischen Kontext zu lösen. Dass dieser kooperative, föderale Ansatz zur Bewältigung rechtlicher Herausforderungen funktioniert, zeigen bereits heute erfolgreiche Initiativen. In Nordrhein-Westfalen hat das Projekt ki-edu-nrw ein umfassendes Rechtsgutachten zur Bedeutung des AI Acts für die Hochschulen veröffentlicht (ki-edu-nrw, 2024). In Baden-Württemberg erarbeitet das Projekt bwDigiRecht kooperativ rechtliche Handreichungen, die allen Hochschulen des Landes als gemeinsamer Orientierungsrahmen dienen (HND-BW, o.D.-b). Diese Beispiele beweisen: Komplexe rechtliche Fragen lassen sich gemeinsam klären, ohne dafür die technologische Vielfalt aufgeben zu müssen. Der AI Act ist somit ein weiteres starkes Argument gegen monolithische Zentralisierung und für eine Stärkung der lokalen Autonomie und Verantwortung.
Fazit: Ein Aufruf zur strategischen Neuausrichtung
Die deutsche Hochschullandschaft steht an einem Scheideweg. Der einfache, bequeme Weg führt in die Zentralisierung, in die Monokultur und letztlich in die strategische Irrelevanz. Der anspruchsvollere, aber einzig zukunftsfähige Weg ist ein mutiges Bekenntnis zu unseren föderalen Stärken.
Anstatt nur Empfehlungen an Hochschulleitungen auszusprechen, sollten wir in der gesamten Hochschulgemeinschaft unser Denken in folgende Richtungen lenken:
- Den Wertschöpfungsort richtig bestimmen. Unsere Souveränität liegt nicht im Nachbau von Benutzeroberflächen, sondern in der intelligenten Anwendung einer Vielfalt von KI-Modellen auf unsere einzigartigen Daten und Prozesse. Wir müssen in die Anwendungsschicht und in die Kompetenz unserer Mitglieder investieren.
- Den Wettbewerb als Innovationsmotor begreifen. Wir sollten eine vielfältige Landschaft von KI-Anbietern – auch innerhalb der Hochschulwelt – aktiv fördern und die Freiheit der Forschung und Lehre verteidigen, das für sie am besten geeignete Werkzeug zu wählen.
- Global kooperieren, lokal innovieren. Wir sollten uns aktiv an internationalen Open-Source-Projekten für die Basisinfrastruktur beteiligen und unsere Entwickler-Ressourcen für die Integration und die Schaffung spezifischer Dienste nutzen.
- Partizipation als Grundvoraussetzung für Akzeptanz anerkennen. KI ist kein IT-Projekt, es ist ein Kulturwandel. Dieser gelingt nur, wenn alle Statusgruppen, insbesondere die Studierenden, aktiv und auf Augenhöhe in die Gestaltung einbezogen werden.
Die technologische Souveränität, die wir anstreben, bemisst sich nicht an der Effizienz eines zentralen Anbieters, sondern an der Fähigkeit unserer Hochschulen, in einem offenen, dynamischen und kompetitiven System innovativ zu agieren. Es ist Zeit, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das ist es, was wir wirklich brauchen.
Die Analyse, die Kernaussagen und die strategischen Thesen dieses Artikels sind das Ergebnis meiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema. Zur Ausarbeitung und sprachlichen Ausformulierung des Manuskripts wurde ein KI-Sprachmodell als redaktionelles Werkzeug genutzt, um die von mir vorgegebenen Konzepte in Textform zu bringen.
Literaturverzeichnis
Budde, J., & Friedrich, J.-D. (Hrsg.). (2024). Monitor Digitalisierung 360° 2023/24. Arbeitspapier Nr. 83. Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/uploads/2024/10/251028_HFD_Monitor_Digitalisierung-360_2324_WEB_RZ.pdf
Budde, J., & Tobor, J. (2025). KI Monitor 2025. Hochschulen gestalten den KI-Alltag. Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/uploads/2025/09/Blickpunkt_KI-Monitor25.pdf
Hochschulforum Digitalisierung. (2023). Expertenanhörung zur Digitalen Souveränität von Hochschulen. https://hochschulforumdigitalisierung.de/expertenanhoerung-souveraene-ki-infrastrukturen/
Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg (HND-BW). (o. D.-a). bwDigiRecht. Abgerufen am 8. September 2025, von https://www.hnd-bw.de/projekte/bwdigirecht/
Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg (HND-BW). (o. D.-b). Archiv Handreichungen bwDR 2.2. Abgerufen am 8. September 2025, von https://www.hnd-bw.de/projekte/bwdigirecht/archiv-handreichungen-bwdr-2-2/
IU Internationale Hochschule. (2024). Syntea – Dein KI-Lernbuddy. Abgerufen am 8. September 2025, von https://www.iu.de/syntea/
Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg (HND-BW) (2025). Schulungsmodul „Verstehen und Anwenden von generativer Künstlicher Intelligenz (KI)“ (v1.1), https://www.hnd-bw.de/themen/hnd-bw-ag-ki-schulungsmodul/
ki-edu-nrw. (2024). Rechtsgutachten von ki-edu-nrw zur Bedeutung der europäischen KI-Verordnung veröffentlicht. Abgerufen am 8. September 2025, von https://ki-edu-nrw.ruhr-uni-bochum.de/rechtsgutachten-von-kiedu-nrw-zur-bedeutung-der-europaeischen-ki-verordnung-veroeffentlicht/
Universität Stuttgart. (2024). Der erste KI-Ingenieur der Welt kommt aus Stuttgart. Abgerufen am 8. September 2025, von https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/meldungen/Der-erste-KI-Ingenieur-der-Welt-kommt-aus-Stuttgart/
Autor

Andreas Sexauer ist Mitarbeiter am Zentrum für Mediales Lernen und setzt sich dort mit digitalen Bildungstechnologien auseinander, damit diese in der Lehre des KIT zum Einsatz kommen. Die momentanen Schwerpunkte sind dabei KI, hybride Lehrformate und Medienproduktion.


 Mauritz Danielsson
Mauritz Danielsson 
 Peter van der Hijden
Peter van der Hijden 
 Annalisa Biehl
Annalisa Biehl 