„Mit uns statt über uns“: KI an Hochschulen partizipativ gestalten
„Mit uns statt über uns“: KI an Hochschulen partizipativ gestalten
20.02.26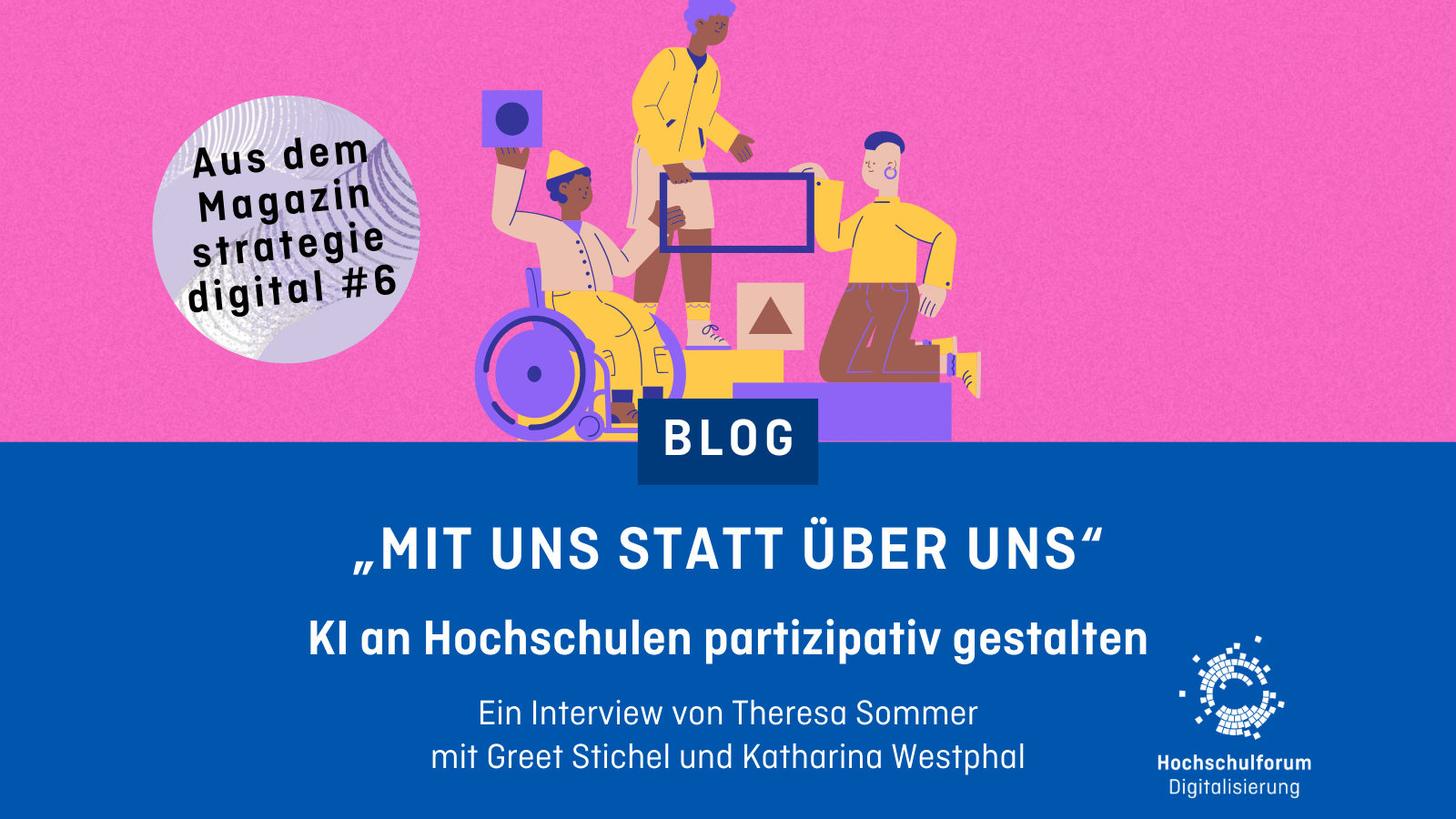
Generative KI stellt vieles in der Hochschulbildung auf den Prüfstand. Doch wie erleben Studierende diesen Wandel und welche Rolle spielt ihre Beteiligung dabei? In dieser Auskopplung aus Magazin #6 von „strategie digital” geben Greet Stichel und Katharina Westphal Einblicke aus studentischer Perspektive: Sie sprechen über erste Berührungspunkte mit KI-Tools, über (fehlende) Strategien an Hochschulen und über den Wunsch nach echter Mitgestaltung. Weitere interessante Artikel zum Thema “Generative KI“ finden Sie in der sechsten Ausgabe des HFD-Magazins strategie digital!
strategie digital: Wann sind Sie zum ersten Mal mit generativer KI in Berührung gekommen?
Katharina Westphal: Ich wurde zum ersten Mal privat durch Social Media und dann relativ schnell im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft für den Bereich eLearning an der Ruhr-Universität Bochum mit Tools wie ChatGPT konfrontiert. Um ein Karteikarten-Tool Studierenden vorzustellen, habe ich die generative KI darum gebeten, für mich eine Liste lateinischer Vokabeln und Übungsaufgaben für den Mathematik-Unterricht mit entsprechenden Lösungen zusammenzustellen. Generative KI wurde in meinem Studium tatsächlich gar nicht thematisiert. Das mag aber auch daran liegen, dass ich mich in den Endzügen meines Masters befand.
Greet Stichel: Im Studium bin ich leider erst sehr spät oder gar nicht direkt mit generativer KI in Berührung gekommen. Meine ersten Erfahrungen hatte ich vielmehr privat, zum Beispiel über Social Media und Instagram. Im Sommer 2023 begann die Universität Greifswald, erste Ansätze zur Nutzung von KI zu vermitteln, etwa durch Empfehlungen zum Umgang mit KI bei Hausarbeiten.
strategie digital: Wie nehmen Sie die Veränderungen durch KI an Ihrer Hochschule aktuell wahr – eher als stillen Wandel oder als aktives Thema?
Greet Stichel: Gemischt. Ich nehme die Veränderungen durch KI an meiner Universität aktuell eher als einen stillen Wandel wahr. Alle wissen, dass sie an verschiedenen Punkten benutzt wird. Viele Studierende nutzen KI-Tools im Alltag durchaus – meist in Form eines „privaten kleinen Assistenten“. Meiner Wahrnehmung nach sind die offiziellen Empfehlungen und Hinweise der Hochschulen zum Umgang mit KI vielen gar nicht bewusst oder sie werden nur am Rande wahrgenommen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema findet oft informell und individuell statt. Die Universität Greifswald stellt für alle eine Version von ChatGPT bereit, welche vom Datenschutz her sicherer ist.
Katharina Westphal: Ich finde, dass der Wandel schon spürbar ist, je nach Fachbereich wird es sehr unterschiedlich geregelt. Meine Universität hat die Nutzung von KI als Hilfsmittel zugelassen, die Ausgestaltung der Regularien aber den Fakultäten überlassen. Je nach Fachbereich gibt es also unterschiedliche Regeln, was bei einigen zu Verunsicherungen führt, wenn sie generative KI nutzen möchten. Beispielsweise haben die Fakultäten für Philologie und Geografie bereits Regeln für die Nutzung generativer KI z. B. für Hausarbeiten festgelegt. Meine eigene Fakultät, die der Geschichtswissenschaft, hat bisher keine Regeln veröffentlicht.
An meiner Uni gibt es Schulungsangebote sowohl für Lehrende als auch für Studierende. Die, die es für Studierende gibt, würde ich selbst nicht besuchen, da sie für Anfänger:innen gedacht sind und eher die technischen Grundlagen vermitteln. Ich würde mir Angebote wünschen, die über eine erste Annäherung hinausgehen. Mich würde interessieren, wie ich generative KI fachspezifisch einsetzen kann, wie ich noch besser prompte, welche ethischen Fragen sich bei der Nutzung von KI ergeben und was in Bezug auf den Schutz von persönlichen Daten beachtet werden muss.
strategie digital: Welche Diskussionen zur KI-Nutzung begegnen Ihnen im Hochschulalltag? Zum Beispiel in Lehrveranstaltungen oder im Austausch mit anderen?
Greet Stichel: Im Hochschulalltag begegnet mir das Thema KI-Nutzung vor allem in Diskussionen darüber, wie Prüfungen oder schriftliche Arbeiten überdacht und angepasst werden müssten, um den Einsatz von KI herauszufiltern oder zu erkennen. Der Austausch mit anderen findet eigentlich ausschließlich in privater Umgebung statt. Was andere Kommiliton:innen – auch aus anderen Fachbereichen – denken oder mitbekommen, bleibt meistens begrenzt. Ich habe aber den Eindruck, dass der Austausch unter Studierenden allgemein zurückgegangen ist.
Katharina Westphal: Ähnlich wie bei Greet geht es in Diskussionen zur KI-Nutzung häufig um Prüfungsleistungen, vor allem, ob Formate wie schriftliche Hausarbeiten durch KI obsolet werden oder wie man Studierende vom Schummeln abhalten könnte. Ich habe schon mal mitbekommen, dass in einer Veranstaltung, in der normalerweise ein Essay die Prüfungsleistung ist, darüber diskutiert wurde, dass die Studierenden das Essay doch in Präsenz schreiben könnten. Solche Diskussionen zeigen meiner Meinung nach, dass wir hinterfragen sollten, ob unsere aktuellen Prüfungsleistungen noch so zeitgemäß sind.
strategie digital: Welche Fragen zur Nutzung von KI im Studium sind für Sie derzeit noch offen oder ungeklärt?
Greet Stichel: Für mich sind derzeit vor allem Fragen offen, wie die Nutzung von KI im Zusammenhang mit Prüfungen bewertet werden kann. Was bedeutet es für unser Lernen, wenn KI-Tools eingesetzt werden – lernen wir dann überhaupt noch „wirklich”? Und wie kann man erfassen, ob und wie Studierende KI nutzen? Auch die Frage, was passiert, wenn jemand KI einsetzt, obwohl es nicht erlaubt ist, bleibt für mich ungeklärt. Wo liegt ganz genau die Grenze? Ich sehe hier auch potenziell unfaire Situationen: Eine Person erledigt alles selbst, während eine andere stark auf KI zurückgreift. Für mich sind das eher pädagogische und didaktische Fragen, die noch nicht ausreichend diskutiert oder geklärt sind.
Katharina Westphal: Wie Greet sehe ich ein großes Fragezeichen bei der zukünftigen Ausgestaltung von Prüfungsleistungen. Meiner Meinung nach sollten wir unsere aktuellen Prüfungsformate wie z. B. Hausarbeiten oder Präsentationen hinterfragen. Wir sollten uns gemeinsam fragen, wie Prüfungsformate mit KI aussehen, ob es noch zielführend ist, alles zu benoten und ob erworbene Kompetenzen nicht viel wichtiger sind. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, welche Kompetenzen wir zukünftig benötigen. Das sind meiner Meinung nach Fragen, die von allen Akteur:innen diskutiert werden sollten, um Antworten darauf zu formulieren.
strategie digital: Was läuft aus Ihrer Sicht im Umgang mit KI an Hochschulen bereits gut und wo sehen Sie noch Luft nach oben?
Katharina Westphal: Gut ist, dass viele Hochschulen gerade dabei sind, KI-Leitlinien zu entwickeln und erste Fortbildungsangebote zu schaffen. Auf Konferenzen bekomme ich mit, dass es viele motivierte Lehrende gibt, die KI bereits kreativ in der Lehre einsetzen und auch mal Dinge ausprobieren. KI wird momentan eher punktuell in Lehrveranstaltungen eingesetzt. Es fehlt häufig an einem gemeinsamen Verständnis, wie KI die Hochschulbildung langfristig verändert. Beteiligung von Studierenden, Weiterbildungsmöglichkeiten und das Hinterfragen bestehender Prüfungsformate sind zentrale Baustellen.
Greet Stichel: Mittlerweile hat sich in der Gesellschaft die Meinung durchgesetzt, dass KI nicht mehr verschwindet. An Hochschulen ist viel in Bewegung, aber wir sind noch längst nicht da, wo wir sein könnten. Was fehlt, ist eine strategisch übergreifende Perspektive. KI wird oft punktuell eingesetzt, etwa in einzelnen Seminaren oder Projekten, aber selten als Teil einer übergreifenden Digitalstrategie gedacht. Auch beim Kompetenzaufbau besteht insgesamt Nachholbedarf. Denn: Was KI mit dem, was wir im Studium lernen, macht, das ist eine der schwierigsten Fragen. Was bedeutet Künstliche Intelligenz für meine spätere Berufspraxis? Gleichzeitig ist es nicht nur schwierig, sondern vielleicht derzeit sogar unmöglich, langfristig oder abschließend gedachte KI-Konzepte zu entwickeln. Es stellt sich dabei die Frage, ob das überhaupt sinnvoll wäre: Klassische langfristige Strategien sind oft schon wieder überholt, bevor sie richtig greifen. Deshalb müssten Konzepte eigentlich viel flexibler gedacht und in kürzeren Abständen angepasst werden.
strategie digital: Sie sprechen von einem fehlenden gemeinsamen Verständnis davon, wie KI die Hochschulbildung langfristig verändert. Was genau heißt das für Sie: Welche Aspekte von Hochschulbildung geraten durch KI in Bewegung?
Greet Stichel: Natürlich denkt man zuerst an Prüfungen, Hausarbeiten und an Lehrende und Studierende. Aber die Veränderungen reichen eigentlich viel weiter: Auch Verwaltung und Hochschulleitung müssen sich mit neuen Anforderungen auseinandersetzen, etwa bei Prüfungsordnungen. Gleichzeitig beeinflusst KI auch das Selbstverständnis und das Image von Hochschulen und Universitäten. Wenn zum Beispiel klassische Leistungsnachweise infrage gestellt werden, braucht es neue Ideen, wie sich eine Hochschule über Qualität und Innovation positioniert. KI verändert das Konzept „Bildung” insgesamt.
Katharina Westphal: Für mich bedeutet das, dass zentrale Grundannahmen über Lehre und Lernen neu verhandelt werden müssen und genau das ist bislang systematisch nicht passiert. KI stellt nicht nur einzelne Methoden oder Tools infrage, sondern verändert grundlegende Aspekte der Hochschulbildung. Wir diskutieren dann nicht nur über Prüfungsformate, sondern z. B. auch über das Kompetenzverständnis: Welche Kompetenzen brauchen wir zukünftig? Wir reden über Veränderungen der Lehr- und Lernkultur und auch über Bildungsgerechtigkeit, denn wer Zugang zu leistungsfähigen KI-Tools hat, könnte potenziell Vorteile im Studium haben. KI stellt also nicht nur infrage, was wir lernen, sondern auch wie, warum und unter welchen Bedingungen. Dazu braucht es aber einen gemeinsamen Orientierungsrahmen, der fächerübergreifend und partizipativ ausgehandelt werden müsste. Momentan sehe ich da noch viele Einzelstrategien.
strategie digital: Was bedeutet studentische Beteiligung bei KI-Themen an Hochschulen für Sie ganz konkret?
Katharina Westphal: Für mich heißt das, dass Studierende nicht nur befragt werden, sondern aktiv mitgestalten, z. B. bei der Entwicklung von KI-Leitlinien, bei der Evaluation von Tools oder bei der Konzeption neuer Lernformate. Diese Art der Beteiligung braucht aber Räume, in denen Ideen der Studierenden ernst genommen werden, und Ressourcen, um studentisches Engagement zu fördern.
strategie digital: Sie sprechen von aktiver Mitgestaltung durch Studierende. Warum sollte studentische Beteiligung beim Thema KI nicht nur für, sondern mit Studierenden erfolgen?
Greet Stichel: Weil Studierende die Zielgruppe der Wissensvermittlung von Hochschulen sind. Es wäre widersprüchlich, über Prozesse zu entscheiden, ohne diejenigen einzubeziehen, die täglich damit umgehen. Wer zukunftsfähige Bildungskonzepte gestalten will, sollte das mit den Studierenden tun – mit uns statt über uns.
Katharina Westphal: Genau. Studierende sind selbst Expert:innen ihres Lernens. Sie wissen selbst, was in der Praxis funktioniert und was nicht. Sie sind die primären Nutzer:innen dieser Technologien. Nur wenn die Sicht von Studierenden in die Diskussion um Lern- und Prüfungsverfahren einfließt, lassen sich Richtlinien formulieren, die realitätsnah, akzeptiert und langfristig wirksam sind. Beteiligung schafft Akzeptanz, verringert das Risiko, dass Vorgaben als Fremdbestimmung wahrgenommen werden und stärkt das Vertrauen in Veränderungsprozesse.
strategie digital: Was müsste sich Ihrer Meinung nach an Hochschulen verändern, damit der Umgang mit KI nicht als „Fremdbestimmung” empfunden wird, sondern als gestaltbarer Prozess?
Katharina Westphal: Meiner Meinung nach müsste erst einmal eine transparente Kommunikation erfolgen. Warum gibt es welche Regeln? Welches Ziel haben sie? Es müssen partizipative Formate geschaffen werden wie z. B. ein KI-Gremium, in dem Studierende, Lehrende und Verwaltung gemeinsam in den Dialog treten, weil es ein gemeinsamer Lernprozess ist. Hochschulen sollten mehr Flexibilität im Studium zulassen. KI verändert den Prozess, wie wir lernen, und das in einer enormen Geschwindigkeit. Hochschulen brauchen Strukturen, mit denen sie auf diese Veränderungsprozesse reagieren können.
strategie digital: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit Beteiligungsformaten gemacht?
Greet Stichel: Vor allem im Rahmen der DCM-Initiative: Dort konnte ich mich in Projekte und Diskussionen einbringen, Veranstaltungen mitgestalten und auch Impulse zu Themen wie KI, digitaler Lehre oder partizipativer Hochschulgestaltung setzen. Dort hatte ich das Gefühl, dass studentische Perspektiven nicht nur willkommen, sondern wirklich gefragt waren. An meiner eigenen Universität gab es zudem Arbeitsgruppen, in denen studentische Stimmen – etwa über die Fachschaften – eingebracht werden konnten.
Katharina Westphal: Wie Greet habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit als DigitalChangeMaker an vielen Austauschformaten teilnehmen können, in denen über Einsatzszenarien, Prüfungsformate oder Leitlinien für eine KI-Strategie für Hochschulen diskutiert wurde. Ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht, meine Perspektive wurde nicht nur angehört, ich habe mich aktiv in Workshops beteiligt und häufig sind bei solchen Veranstaltungen Lehrende oder Entscheider:innen auf mich zugekommen und haben sich dafür bedankt, dass ich in meiner Rolle als Studentin meine Sicht auf das Thema eingebracht habe. Das ist aber leider nicht überall so. Es hängt auch oft von Einzelpersonen ab, ob Studierende bei Tagungen oder anderen Gesprächsformaten am KI-Diskurs beteiligt werden.
Die DigitalChangeMaker-Initiative des Hochschulforums Digitalisierung bringt seit 2018 engagierte Studierende aus ganz Deutschland zusammen, um Hochschulbildung aktiv mitzugestalten. Als bundesweiter studentischer Think Tank entwickeln sie Forderungen, setzen Impulse und beraten Hochschulen bei der lernendenzentrierten und zukunftsfähigen Transformation. Mit eigenen Projekten und Perspektiven bringen sie sich wirkungsvoll in hochschulübergreifende Entwicklungsprozesse ein.
strategie digital: Welche Empfehlungen würden Sie Hochschulleitungen geben, die sich mehr studentische Beteiligung wünschen, aber nicht wissen, wo sie ansetzen sollen?
Greet Stichel: Viele Studierende wollen sich einbringen, aber es fehlt oft an passenden Formaten oder an dem Gefühl, dass ihre Stimme wirklich zählt. Beteiligung funktioniert nicht, wenn man erst ganz am Ende fragt: „Und, was meint ihr dazu?“. Es braucht echte Mitgestaltung von Anfang an. Ein guter erster Schritt ist, auf bestehende Strukturen zuzugehen: Fachschaften, studentische Initiativen oder einzelne engagierte Studierende. Die sind oft schon sehr aktiv und kennen die Themen. Formate wie offene Gespräche, Workshops oder sogar informelle Austauschformate können schon viel bewirken, wenn man sie regelmäßig anbietet und transparent macht, was daraus entsteht. Wertschätzung spielt eine große Rolle: Beteiligung kostet Zeit und Energie – gerade neben dem Studium.
Studierende haben durch Social Media und ihre digitale Lebenswelt oft eine Art Informationsvorsprung: Sie wissen, was es gibt. Welche Tools, welche Plattformen oder was an anderen Unis schon läuft. Das ist eine Ressource: Wenn Hochschulleitungen diese Erfahrungen aktiv einbeziehen, könnten sie davon profitieren.
Katharina Westphal: Hochschulen sollten einfach erst mal anfangen, z. B. mit einem studentischen KI-Beirat oder partizipativen Workshops. Auf Tagungen habe ich häufig gehört, dass es schwierig sei, Studierende für solche Gremien zu gewinnen. Hochschulen sollten meiner Meinung nach überlegen, ob ehrenamtliche Tätigkeit wie die Arbeit in einem Gremium mit Creditpoints im außercurricularen Bereich honoriert werden könnte, die Universität Göttingen hat dafür beispielsweise ein Modul geschaffen. Man könnte auch darüber nachdenken, ob das nicht auch Tätigkeiten sind, bei denen es eine Aufwandsentschädigung geben könnte oder ob studentische Hilfskräfte dafür Arbeitsstunden erhalten würden. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Maßnahmen die Motivation von Studierenden erhöhen könnten, sich an solchen Formaten zu beteiligen und es würde Studierenden auch Wertschätzung entgegenbringen.
Und am wichtigsten: Hochschulen sollten Studierenden Vertrauen schenken. Studierende kommen an unsere Hochschulen, weil sie etwas lernen wollen. Sie haben viele Ideen, die man sich anhören und ernst nehmen sollte. Beteiligung ist meiner Meinung nach deshalb kein Add-on, sondern Voraussetzung für eine zukunftsfähige Hochschulbildung.
Unter dem Titel „Wie KI die Lehre verändert“ diskutieren im Abschlusswebinar der Reihe „CHEtalk feat. Hochschulforum Digitalisierung“ am 24. Februar 2026 Lehrende und Studierende, wie sich Selbstverständnis, Zusammenarbeit und Partizipation unter dem Einfluss von generativer KI wandeln und welche Chancen und Herausforderungen daraus entstehen. Diskutieren werden Stefanie Go (TH OWL und Universität Bielefeld), Kathrin Schelling (TH OWL), Greet Stichel (Universität Greifswald) und Katharina Westphal (Ruhr-Universität Bochum).
CHEtalk feat. HFD: Generative KI als Gamechanger?! – Wie KI die Lehre verändert
Interviewpartnerinnen

Greet Stichel ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Greifswald. Zudem ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. Als eTutorin und DigitalChangeMaker beschäftigt sie sich insbesondere mit Fragen digitaler Lehre und Forschung.

Katharina Westphal ist Lehramtsstudentin (M. Ed.) an der Ruhr-Universität Bochum. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrung in der digitalen Hochschulbildung, unterstützt aktuell als studentische Mitarbeiterin in der Professional School of Education der RUB zu OER und ist seit 2024 als DigitalChangeMaker aktiv.
Autorin

Theresa Sommer ist Projektmanagerin im Hochschulforum Digitalisierung für das CHE Centrum für Hochschulentwicklung und ist als Redaktionsleitung für die aktuelle Ausgabe des Magazins strategie digital verantwortlich. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen nachhaltige Digitalisierung sowie im Monitoring von Digitalisierungsprozessen an Hochschulen.


 Mauritz Danielsson
Mauritz Danielsson 
 Peter van der Hijden
Peter van der Hijden 
 Annalisa Biehl
Annalisa Biehl 