KI und Learning Analytics – Eindrücke aus Norwegen
KI und Learning Analytics – Eindrücke aus Norwegen
26.08.25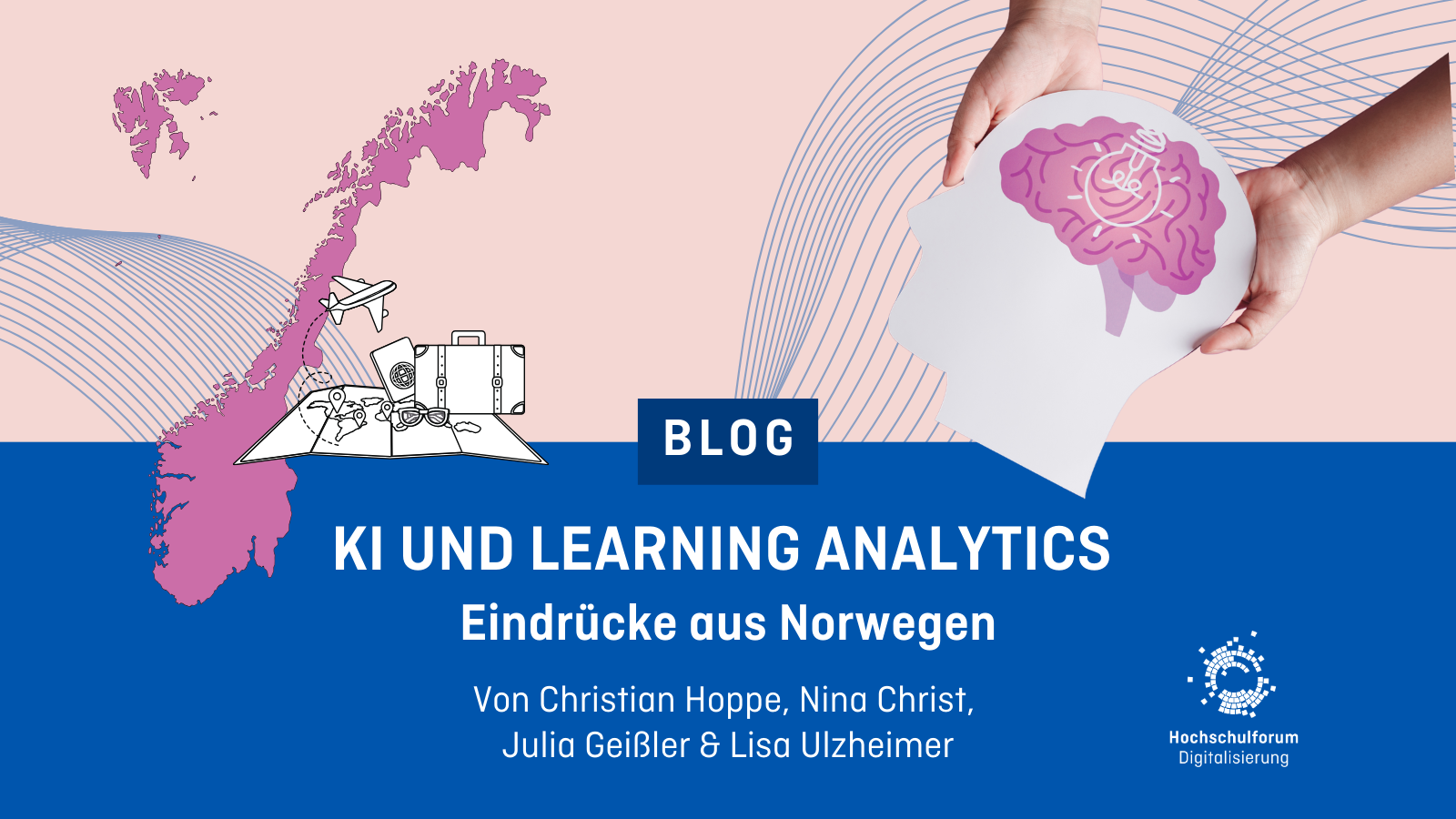
Im Mai 2025 reisten wir – gefördert vom Hochschulforum Digitalisierung (HFD) – als Delegation mit vielen Fragen rund um die Themen „AI und Learning Analytics im universitären Lehr-Lern-Kontext“ an die University of Bergen in Norwegen. Unsere Reise zeichnete sich durch eine Fülle an positiven Eindrücken und neuen Erkenntnissen aus.
Bereits bei unserer Ankunft am Bahnhof war die engagierte Zielsetzung Norwegens spürbar, bis 2030 als eines der weltweit führenden digitalisierten Länder dazustehen: Überraschenderweise gab es keine Fahrkarten mehr in Papierform. Unsere Delegation strebte in Norwegen nicht nur den Austausch von Erfahrungen an, sondern auch die Diskussion und Weiterentwicklung spezifischer Ideen und Ansätze. Im Mittelpunkt unserer Überlegungen standen folgende Themen:
- methodisch-didaktische Ansätze zur Implementierung und Nutzung von Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz (KI) in der Hochschulbildung
- technische Infrastrukturkonzepte für Learning Analytics– und KI-Systeme
- die Entwicklung einer Learning Analytics Policy als hochschulweites Instrument zur Steigerung des Bewusstseins
HK-dir und SIKT: Treibende Kräfte hinter der Digitalisierung in Norwegen
Während unserer Reise wurde uns bewusst, welche zentrale Rolle HK-Dir (die Direktion für Hochschul- und Universitätsbildung in Norwegen) und SIKT (eine staatliche Organisation zur Förderung von IT-Infrastruktur) in der digitalen Transformation des norwegischen Bildungssystems einnehmen. Dies ist hier nicht nur im Schul- und Hochschulbereich zu sehen, sondern umfasst ebenfalls die erwachsene Bevölkerung.
HK-dir, das norwegische Direktorat für Hochschulbildung und Kompetenzen, hat vielfältige Aufgaben und Rollen, die für den Bildungsbereich in Norwegen von zentraler Bedeutung sind:
- Berater:in: HK-dir agiert als beratende Instanz, die auf evidenzbasierte Berichte zurückgreift, um die Hochschulbildung und Kompetenzentwicklung zu unterstützen. Ihre Empfehlungen basieren auf Forschung und Praxiserfahrungen.
- Initiator:in: Das Direktorat fördert neue Initiativen und Projekte, die darauf abzielen, die digitalen und KI-Kompetenzen in der Hochschulbildung zu stärken.
- Koordinator:in: HK-dir koordiniert und vernetzt die verschiedenen Akteur:innen im Bildungsbereich, um einen effektiven Austausch von Erfahrungen und Ressourcen zu ermöglichen. Sie arbeiten daran, gemeinsame Richtlinien und Rahmenbedingungen, zum Beispiel in Hinblick auf Prüfungen und KI, zu entwickeln.
SIKT (Norwegian Agency for Shared Services) unterstützt als zentrale technische Schnittstelle durch die Bereitstellung umfassender IT-Infrastrukturen Besonders der Aufbau sicherer und zuverlässiger Netzwerke steht im Vordergrund. Dies dient dem Ziel, eine weitreichende Digitalisierung der Lehre zu ermöglichen, die sich durch Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Die Arbeitsweise von SIKT ist geprägt von den folgenden Merkmalen:
- Nationale IT- und Dateninfrastruktur: SIKT kümmert sich um den Aufbau und die Pflege einer effizienten IT- und Dateninfrastruktur, die die Grundlage für den digitalen Betrieb von Hochschulen und Forschungseinrichtungen bildet.
- Förderung standardisierter IT-Lösungen: Sie fördern die Einführung standardisierter IT-Lösungen, wie zum Beispiel Canvas als Lernmanagementsystem (LMS), um eine einheitliche digitale Lernumgebung bereitzustellen.
- Verwaltung von Forschungsdaten und Publikationen: SIKT unterstützt die Verwaltung von Forschungsdaten und wissenschaftlichen Publikationen, um sicherzustellen, dass diese konsistent und sicher gehandhabt werden.
- Beratung zu Datenschutz und rechtlichen Fragen: Die Agentur bietet umfassende Unterstützung und Beratung zu Datenschutzfragen, um den rechtlich einwandfreien Einsatz von Technologien an den Hochschulen zu garantieren.
- Produktorientierte Teams: Diese Teams arbeiten eng mit Fachexpert:innen aus den jeweiligen Institutionen zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die auf den spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen der Hochschulen basieren.
- Aufbau eines KI-Labs und Unterstützung von KI-Projekten: SIKT ist auch in den Aufbau von KI-Laboren involviert und fördert aktiv Projekte, die den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung erforschen und vorantreiben.
Wir waren beeindruckt von der Fähigkeit dieser Organisationen, standardisierte IT-Lösungen zu entwickeln, die nicht nur Compliance und Datenschutz sicherstellen, sondern auch Innovation und Flexibilität fördern.
Learning Analytics und die Brücke zur Praxis
Vor dem aktuellen Aufschwung der Künstlichen Intelligenz (KI) wurde Learning Analytics (LA) national als äußerst wichtig für die Bildungslandschaft priorisiert. Die Idee war, durch datengestützte Entscheidungen die Lehr- und Lernqualität nachhaltig zu verbessern. Mit dem Aufkommen des KI-Trends hat sich die Priorisierung verschoben.
Dabei bieten Datenanalyseverfahren weiterhin vielversprechende Ansätze, um Lernprozesse zu optimieren und das Lernen an Hochschulen gezielt zu unterstützen. Im SLATE Institute wird hierzu umfassende Forschung betrieben. SLATE ist ein norwegisches nationales Zentrum für Learning Analytics, das sich mit technologischen, pädagogischen und rechtlichen Aspekten von KI beschäftigt und den verantwortungsvollen Einsatz dieser Technologien im Bildungswesen fördert. SLATE verbindet interdisziplinäre Forschung mit Politikberatung und arbeitet national sowie international an der Schnittstelle von Bildung, Technologie und Gesellschaft. Als Delegation erhielten wir einen spannenden Einblick in den Forschungsalltag des internationalen und interdisziplinären Teams.
Hier zeigte sich nun auch eine Diskrepanz zwischen Forschung und Praxis. An den staatlichen Universitäten in Norwegen, einschließlich der Universität Bergen, existieren bislang keine spezifischen Papiere, wie Policies oder Leitlinien zu Learning Analytics in der Lehre. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bisher kaum ein Praxistransfer stattgefunden hat. Im Gegensatz dazu arbeitet die „BI Norwegian Business School“ in Oslo mit einer entsprechenden Policy, um den Einsatz von Learning Analytics anwenden zu können und dabei die Rechte der Studierenden zu wahren.
Um Learning Analytics sinnvoll zu nutzen, müssen die beteiligten Akteur:innen passende Kompetenzen entwickelt werden. Hierzu zählt insbesondere Data Literacy, um einen reflexiven Umgang damit zu ermöglichen und zu fördern. Darüber hinaus braucht es, besonders für den Bereich Learning Analytics, die Fähigkeit, visuell aufbereitete Daten zu verstehen, zu interpretieren und ausgehend davon Maßnahmen abzuleiten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Norwegen im Bereich Learning Analytics im praktischen Hochschulalltag ähnlich fortgeschritten ist wie Deutschland. Es gibt vereinzelte Leuchtturmprojekte. Flächendeckend befindet sich allerdings kein System in der Anwendung. Zudem herrscht eine skeptische bis unsichere Grundhaltung bei Fragen der Datensicherheit und, grundlegender, des eigentlichen Mehrwerts von Learning Analytics.
Künstliche Intelligenz @ UiB
Die Universität Bergen setzt KI auf vielfältige Weise ein, um Bildung und Forschung zu bereichern. Ein zentraler Aspekt ist die technische Infrastruktur, die unter anderem das eigene Interface „UiB-Chat“ (datenschutzkonform aus Basis von Chat-GPT) und MS Copilot umfasst.
Jede Fakultät verfügt über eine spezifische KI-Policy, um den Einsatz von KI-Technologien im Einklang mit ethischen und datenschutzrechtlichen Standards zu gewährleisten. Zudem existiert mit „UiB AI“ ein koordiniertes Board, das Mitglieder aus verschiedenen Fakultäten umfasst, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern.
Verschiedene Institutionen innerhalb der Universität entwickeln Weiterbildungsangebote, die die Anwendung von KI in Lehr- und Lernprozessen adressieren.
Die Universität verfügt außerdem über eine starke Forschungsinfrastruktur für KI, die durch das SLATE-Institut unterstützt wird. Besonders spannend war die strategische Ausrichtung in mehreren Projekten: EduTrust AI untersucht Vertrauen in KI im Bildungskontext als soziales Phänomen, während AI Learn und AI Create die menschlich-technologische Ko-Evolution in Lernsettings analysieren – von kollaborativer Kreativität bis zu hybrider Intelligenz.
Spannend fanden wir auch die Vorstellung des Chatbots Inez. Das ist ein KI-gestützter Chatbot, der im Projekt Lead AI entwickelt wurde und als kreative Workshop-Facilitatorin fungiert. Der Chatbot arbeitet kollaborativ mit Gruppen, kann jedoch nicht spontan unterbrochen werden und neigt dazu, „schlechte Angewohnheiten“ zu lernen. Die Interaktion mit Inez basiert auf hybriden Kollaborationsformen, bei denen ein Mensch mit mehreren KI-Agenten zusammenarbeitet (human–AI–AI co-creation). Emotionale Reaktionen wie Faszination, Frustration oder sogar Freundschaft mit dem Chatbot wurden beobachtet. Obwohl Inez kreative Prozesse unterstützen kann, zeigt sich, dass etwa Workshops mit mehr als sieben Personen schwer durchführbar sind. Zudem besteht Bedarf an pädagogischen Rahmenkonzepten für den produktiven Einsatz solcher KI-Systeme. Inez basiert auf Technologien von OpenAI.
Außerdem besuchten wir das „UiB Learning Lab“, das Lehre, Lernen und Innovation an der Universität Bergen unterstützt. Es bietet unter anderem Medienproduktion (Podcasts,Videos, etc.), Studiengangsentwicklung sowie Workshops und Seminare an. Seit seiner Gründung 2017 ist es ein zentraler Baustein der universitären Lehr- und Innovationsförderung. In einer Matrix-Organisation arbeiten rund 25 Kolleg:innen aus verschiedenen Verwaltungsbereichen gemeinsam in Themenfeldern wie Hochschuldidaktik, Learning Design, Bildungstechnologien und Medienproduktion. Das Learning Lab versteht sich als „working community“ und arbeitet projektbasiert mit verschiedenen Einrichtungen der Universität zusammen. Beeindruckt hat uns vor allem das Matrix-Organisationsmodell, das interdisziplinäre Zusammenarbeit erleichtert. Geplant sind dort unter anderem Einführungskurse für Mitarbeitende zum Thema KI, da die Vorkenntnisse in dieser Zielgruppe besonders stark variieren. Besonders spannend ist der Ansatz, Führungskräfte gezielt so zu schulen, dass sie die Potenziale und Herausforderungen von KI-Use-Cases mit ihren Teams reflektieren können. Beim Austausch mit den Kolleg:innen dort wurde außerdem deutlich: Viele Herausforderungen ähneln sich. Auch in Bergen ist digitale Lehre oft noch „nice to have“ statt Standard und die Präsenzlehre dominiert weiterhin.
Die University Pedagogy (UPED) bietet ein umfassendes Weiterbildungsangebot im Umfang von 200 SWS. Dieses Weiterbildungsangebot ist für Lehrende verpflichtend und wird durch hochschuldidaktische Beratungen unterstützt. Eines davon ist das Wahlmodul „Nutzung großer Sprachmodelle und künstlicher Intelligenz für Lehren und Lernen“. Dieses Modul ist darauf ausgerichtet, den praktischen Einsatz von KI in Lehrprojekten zu fördern und beinhaltet Peer-Reviews sowie Reflexionen der Anwendungsfälle.
Handlungsempfehlungen
Unser Aufenthalt in Norwegen hat uns zahlreiche Einsichten für die Digitalisierung des deutschen Hochschulsektors gegeben. Die gewonnenen Erkenntnisse möchten wir in Form von konkreten Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in Deutschland zusammenfassen:
1. Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit
Die Matrix-Organisation der Uni Bergen hat uns überzeugt, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit essenziell für Innovationen im Bildungsbereich ist. Daher empfehlen wir die Einführung von ähnlichen Strukturen an deutschen Hochschulen, die es Fachexpert:innen ermöglichen, Expertise zu bündeln und in dynamischen Projekten zusammenzuarbeiten. Diese Teams sollten aus Vertretungen unterschiedlicher Disziplinen bestehen, um verschiedene Perspektiven zu integrieren und kreative Lösungen zu entwickeln.
2. Ausbau von AI Literacy und Datenkompetenz
Eine zentrale Erkenntnis unserer Reise war die unerlässliche Bedeutung von AI Literacy und Datenkompetenz für alle Bildungsakteur:innen. Es ist dringend notwendig, beide Themen systematisch in den Curricula zu verankern und nicht nur als fakultative Zusatzqualifikation zu begreifen. Während es international bereits viele Forschungen und Pilotprojekte im Bereich Learning Analytics gibt, bleibt die praktische Anwendung oftmals hinter den Erwartungen zurück – nicht zuletzt, weil es an breiter Kompetenz im Umgang mit KI-gestützten Verfahren und an Akzeptanz fehlt. Datenschutz nimmt dabei eine Schlüsselfunktion ein, die besondere Aufmerksamkeit erfordert. Es wurde deutlich, dass die Förderung von Datenkompetenz für alle Educational Stakeholder elementar ist, um datenbasierte Systeme wie Learning Analytics verantwortungsvoll nutzen und bewerten zu können.
Die norwegische Digitalisierungsstrategie betont in diesem Zusammenhang besonders die Notwendigkeit, KI-Kompetenz auf allen Ebenen zu stärken: Studierende, Lehrende und Hochschulleitungen sollen grundlegendes Wissen über Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten, Risiken und ethische Fragestellungen im Kontext von KI und Datenanalyse erwerben. Vorreiter wie die Universitäten in Bergen (UiB) und Agder (UiA) integrieren bereits digitale und KI-bezogene Inhalte in alle Studiengänge, um Arbeitsmarktrelevanz und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit zu sichern. Ergänzend dazu sollen Spezialkompetenzen für den gezielten Einsatz von KI in Lehre, Lernraumgestaltung, Prüfungspraxis und Forschung aufgebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Schulung zu rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen sowie der Koordination von KI-Initiativen innerhalb der Hochschulen. Für Deutschland wäre ein vergleichbarer Kompetenzaufbau über alle Bildungsbereiche hinweg ebenso dringend notwendig, um die Chancen von KI-Technologien nachhaltig und verantwortungsbewusst nutzen zu können.
3. Ganzheitliche Digitalisierungsstrategien
Eine umfassende Digitalisierungsstrategie, ähnlich der norwegischen bis 2030, wäre für Deutschland vorteilhaft. Norwegen verfolgt mit seiner nationalen Digitalisierungsstrategie das ambitionierte Ziel, bis 2030 eines der am stärksten digitalisierten Länder der Welt zu werden. Die Strategie umfasst den öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen Bereich und legt einen besonderen Fokus auf den ethischen und sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Bis 2030 soll eine nationale KI-Infrastruktur aufgebaut werden, die u. a. den Zugang zu Basismodellen auf Norwegisch und in Sámi-Sprachen sowie an norwegische gesellschaftliche Rahmenbedingungen angepasst ermöglicht. Begleitend dazu plant die Regierung Maßnahmen wie die rechtliche Klärung von Text- und Datennutzung, die Umsetzung der EU-KI-Verordnung in nationales Recht und die Einrichtung eines Forschungszentrums für KI in der Gesellschaft. Auch im Hochschulbereich gibt es eine eigene Strategie für digitale Transformation (2021–2025), die eng mit der nationalen Digitalisierungsstrategie verzahnt ist. Übergreifende Ziele der aktuellen langfristigen Forschungs- und Bildungsstrategie (2023–2032) sind die Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, gesellschaftlicher und ökologischer Wirkung sowie der Qualität und Zugänglichkeit von Bildung und Forschung.
Die norwegische Strategie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur technologische Entwicklungen adressiert, sondern explizit auch ethische, gesellschaftliche und bildungspolitische Fragestellungen in den Blick nimmt. Sie formuliert klare Visionen und umsetzbare Meilensteine, etwa zum Einsatz von KI in der Hochschullehre und zum Aufbau einer nationalen Dateninfrastruktur für den Bildungsbereich.
Für Deutschland könnte eine vergleichbare nationale Strategie dazu beitragen, die derzeit noch stark fragmentierten Aktivitäten zur Digitalisierung im Bildungsbereich zu bündeln und eine gemeinsame Zielrichtung zu definieren. Insbesondere für sensible Themen wie den Einsatz von Learning Analytics und KI in der Lehre wäre es wichtig, eine übergreifende Leitlinie zu etablieren, die Hochschulen und Bildungseinrichtungen Orientierung bietet. Dazu sollten neben technologischen und rechtlichen Aspekten auch Fragen der digitalen Souveränität, Ethik und Teilhabe systematisch berücksichtigt werden. Ein begleitendes Monitoring- und Beratungsgremium – bestehend aus Expert:innen aus Wissenschaft, Technik, Recht und Gesellschaft – könnte gewährleisten, dass die Strategie nicht nur ambitioniert, sondern auch praxisnah und anschlussfähig bleibt. Der Blick nach Norwegen zeigt, dass ein solcher integrierter Ansatz möglich und wirksam sein kann.
4. Verbesserung der praktischen Umsetzungen von Learning Analytics
Trotz zahlreicher Forschungsinitiativen bleibt die Lücke zur praktischen Umsetzung von Learning Analytics, ähnlich wie in Deutschland, bestehen. Unsere Empfehlung ist, engere Partnerschaften mit Forschungszentren, wie SLATE, zu knüpfen, die dabei helfen könnten, Forschungsergebnisse direkt in den Lehrbetrieb zu integrieren. Der hierbei gewonnene Mehrwert kann durch gezielte Pilotprojekte demonstriert werden.
5. Datenmanagement und Datenschutz
Es ist entscheidend, dass Bildungseinrichtungen einen einheitlichen und tragfähigen Ansatz für Datenmanagement und Datenethik entwickeln, um den datenschutzkonformen und verantwortungsvollen Einsatz von KI und Learning Analytics in Forschung und Lehre zu gewährleisten. Derzeit existieren vielerorts noch sehr unterschiedliche Regelungen und Unsicherheiten, insbesondere im Umgang mit personenbezogenen Lern- und Leistungsdaten. Ein klar definierter und transparent veröffentlichter institutioneller Rahmen kann hier nicht nur Rechtssicherheit schaffen, sondern auch die Akzeptanz unter Lehrenden, Studierenden und Mitarbeitenden erhöhen. Dabei ist es sinnvoll, bestehende nationale und europäische Vorgaben wie die DSGVO konsequent zu berücksichtigen und sie in hochschulspezifische Leitlinien zu überführen.
Gleichzeitig bietet es sich an, Kollaborationen mit technologisch führenden Institutionen und Hochschulnetzwerken – auch international – zu suchen, um von deren Erfahrungen, Lösungen und Standards zu profitieren. Der Austausch mit norwegischen Hochschulen im Rahmen der Reise hat gezeigt, wie wertvoll solche Kooperationen sein können. Insbesondere im Bereich der technischen Infrastruktur, der Governance-Modelle und der ethischen Begleitung von KI-Systemen lassen sich durch internationale Vernetzung Synergieeffekte erzielen. So können Hochschulen nicht nur ihre eigene digitale Souveränität sichern, sondern auch innovationsfreundliche und zugleich verantwortungsvolle Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI in der akademischen Bildung schaffen. Das Mindset „digital und modern Lehren mit Datenschutz“ und nicht trotz Datenschutz oder verhindert durch Datenschutz, war in Norwegen eine erfrischende Erkenntnis. Dazu gehört auch, sichtbar gemachte Daten als eine Möglichkeit der (persönlichen) Weiterentwicklung und Hilfestellung zu sehen und sich nicht nur auf die negative Seite eines möglicherweise gläsernen Studierenden zu konzentrieren.
6. Einbindung skeptischer Stimmen und Mitgestaltung
Von Anfang an sollten skeptische Stimmen in den Digitalisierungsprozess einbezogen werden, um Bedenken gegenüber neuen Technologien abzubauen und die Akzeptanz zu erhöhen. Ein offener Dialog, der kritisches Denken fördert, kann eine konstruktive Diskussionskultur schaffen und Ängste sowie Vorurteile abmildern. Besonders deutlich wurde dieser Aspekt im norwegischen KI-Strategiepapier für Hochschulen (HK-dir paper on AI in higher education), das betont, wie wichtig es ist, auch technologiekritische Perspektiven systematisch einzubinden. Sicherlich lässt sich dieses Anliegen auch auf den deutschen Kontext übertragen, denn auch hier herrscht weitgehend Konsens darüber, dass ein erfolgreicher und verantwortungsvoller Umgang mit KI und Learning Analytics nur dann gelingt, wenn unterschiedliche Sichtweisen und Vorbehalte frühzeitig berücksichtigt werden. Auf Nachfrage, wie norwegische Kolleg:innen dies konkret umsetzen, zeigte sich allerdings, dass es bislang an erprobten Formaten mangelt. Ähnlich ist die Situation hierzulande. Daher braucht es innovative und niedrigschwellige Formate, um gerade Skeptiker:innen an das Thema heranzuführen, ihre Perspektiven produktiv einzubinden und so eine gemeinsame Diskussions- und Gestaltungsgrundlage für den Einsatz von KI-Technologien in der Hochschulbildung zu schaffen.
7. Ressourcenoptimierung durch Kooperation
Schließlich ist die Bedeutung der Zusammenarbeit und des Austausches von Ressourcen zwischen Institutionen nicht zu unterschätzen. Ein gemeinschaftlicher Ansatz bei der Nutzung und Entwicklung von Technologien könnte Infrastrukturkosten minimieren und die Erreichung gemeinsamer Ziele beschleunigen.
Fazit
Mit diesen Handlungsempfehlungen wollen wir einen Weg aufzeigen, wie Deutschland von den digitalen Fortschritten in Norwegen lernen und die zugrundeliegenden Strategien und Maßnahmen an unsere eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Es liegt eine große Chance darin, die Digitalisierung des Bildungssektors voranzutreiben und dadurch die Qualität der Lehre nachhaltig zu verbessern.
Unsere Reise nach Norwegen hat wertvolle Einblicke in die strategische und verantwortungsvolle Digitalisierung des Hochschulbereichs gegeben. Besonders beeindruckt hat uns der integrierte Ansatz, mit dem Themen wie KI, Learning Analytics, Datenschutz und Ethik zusammengedacht und in nationale sowie hochschulspezifische Strategien überführt werden. Die norwegische Digitalisierungsstrategie bis 2030 setzt dabei klare Ziele, fördert AI Literacy und Datenkompetenz auf allen Ebenen und betont die Einbindung kritischer Stimmen von Beginn an. Während auch in Norwegen praktische Umsetzungen teils noch in der Entwicklung sind, konnten wir wertvolle Impulse und konkrete Ansätze für die deutsche Hochschullandschaft mitnehmen – etwa für den Aufbau verlässlicher Strukturen für das Datenmanagement, für die Stärkung digitaler Future Skills und die Förderung einer verantwortungsvollen Diskussionskultur rund um KI in der Lehre.
Weitere Informationen zu unseren Gesprächspartner:innen und den besuchten Institutionen finden sich im verlinkten Taskcards-Board. Dieses wurde während der Reise kontinuierlich gepflegt und ergänzt.
Danksagung
Ein Dank gilt unseren norwegischen Gesprächspartner:innen, die uns spannende Einblicke in ihre Arbeit und Perspektiven auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Learning Analytics im Bildungsbereich gegeben haben.
Unser ganz besonderer Dank geht an Barbara Wasson (Slate Institute der Universität Bergen), die uns mit großer Herzlichkeit empfangen und maßgeblich bei der Organisation dieser Delegationsreise unterstützt hat. Dank ihres beeindruckenden Netzwerks konnten wir mit zahlreichen Expert:innen ins Gespräch kommen und von vielfältigen Impulsen profitieren.
Nicht zuletzt möchten wir dem Hochschulforum Digitalisierung (HFD) danken, das diese Reise ermöglicht hat.
Autor:innen

Christian Hoppe leitet den Arbeitsbereich E-Learning in der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle an der Technischen Universität Darmstadt. Dort ist er für die Koordinierung der zentralen Angebote und Innovationsprojekte im Bereich der digital-gestützten Lehre zuständig.

Nina Christ ist an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden in der Abteilung Studium und Lehre tätig. Ihr Fokus liegt auf der mediendidaktischen Unterstützung von Lehrenden – insbesondere beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Hochschullehre, den sie beratend und konzeptionell begleitet.

Julia Geißler gehört zum Team der Abteilung Studium und Lehre an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Sie unterstützt Lehrende in der täglichen mediendidaktischen Beratung und bringt ihre Expertise in die Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur ein. Ihre thematischen Schwerpunkte reichen dabei von Gamification in der Lehre bis hin zum Einsatz von Learning Analytics zur Optimierung von Lehr-Lern-Prozessen.

Lisa Ulzheimer arbeitet ebenfalls in der Abteilung Studium und Lehre der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Sie ist sowohl an der mediendidaktischen Beratung als auch an der Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur beteiligt – mit besonderem Augenmerk auf dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Lehrkontexten.





 Mauritz Danielsson
Mauritz Danielsson 
 Peter van der Hijden
Peter van der Hijden 
 Annalisa Biehl
Annalisa Biehl 