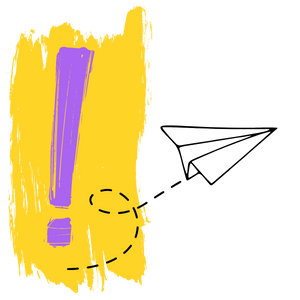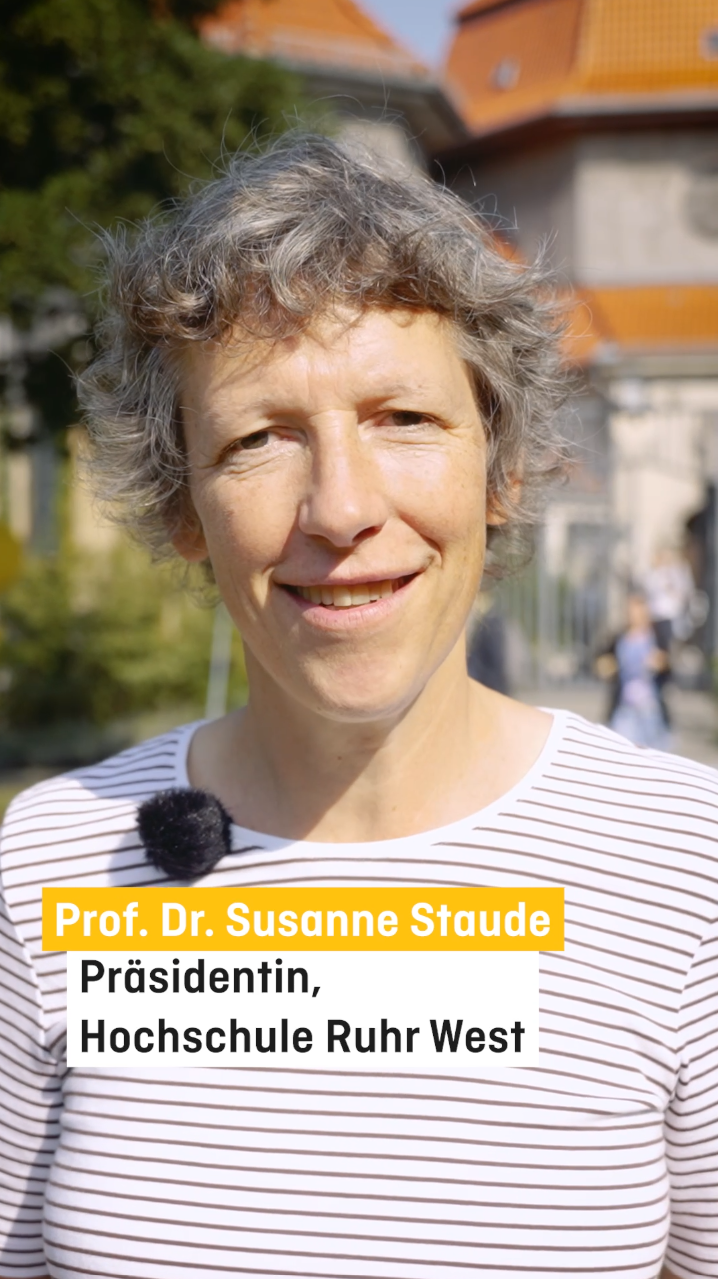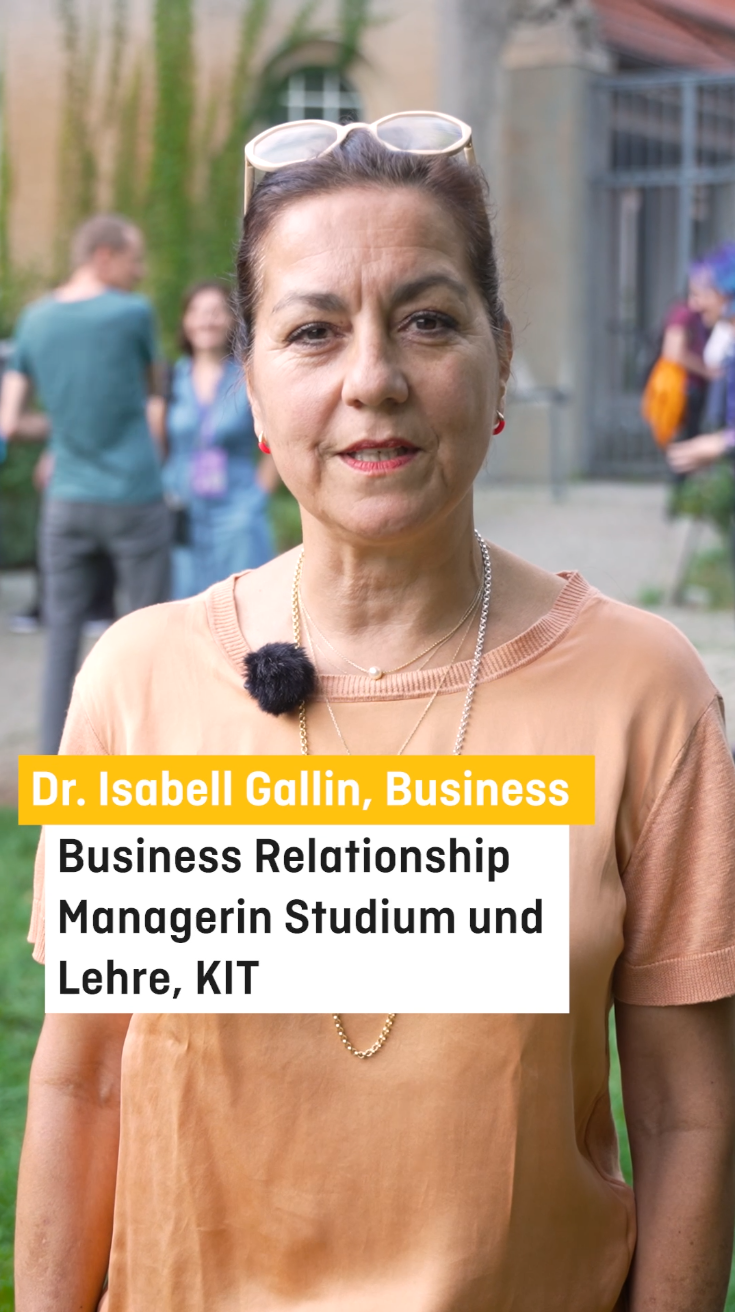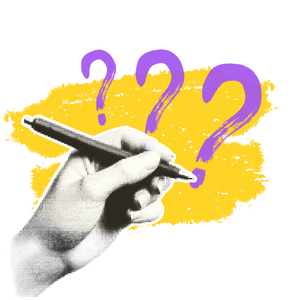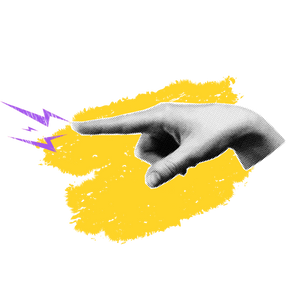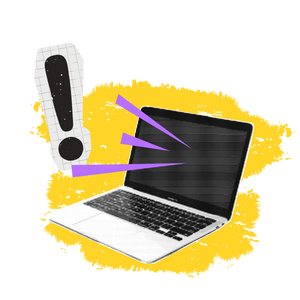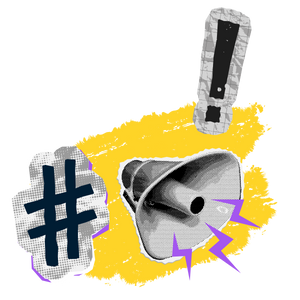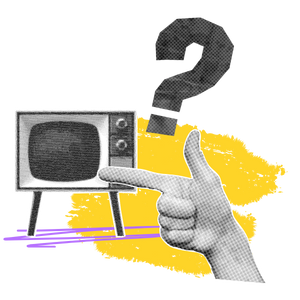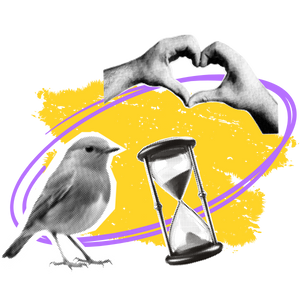Agora [Zukunft] – ein kontinuierlicher Prozess
Das Hochschulforum Digitalisierung möchte zentrale Herausforderungen und Zukunftsfragen der digitalen Transformation an Hochschulen sichtbar machen, gemeinsam mit der Community einordnen und konkrete Handlungsperspektiven entwickeln. Hierfür ist die Agora [Zukunft] als mehrstufiger Prozess angelegt.
Der Prozess umfasst die Community-Umfrage, die Auswertung der Ergebnisse, das Community-Event mit Austausch und Workshops sowie die Überführung der Impulse in Aktivitäten des HFD. Damit entsteht ein jährlicher Zyklus, der die Community kontinuierlich begleitet und auf ihre Erfahrungen und Expertisen zurückgreift.


![Kreisförmige Prozessillustration von Agora [Zukunft]. Drei farbige Kreise mit Icons sind durch Pfeile verbunden: Community-Umfrage – Bedarfe sichtbar machen (Symbol: Balkendiagramm). Auswertung – Problemfelder systematisieren (Symbol: Lupe). Community-Event – Diskussionen und Workshops (Symbol: Handschlag). In der Mitte: Handlungsansätze und Materialien – Impulse in HFD-Aktivitäten übertragen (Symbol: Glühbirne).](https://hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/uploads/2025/10/Agora-Zukunft-Prozessillustration-2-e1760435605346.png)