Zwischen digitaler Innovation und wissenschaftlicher Tradition – Was verstehen wir unter Hochschulbildung im 21. Jahrhundert?
Zwischen digitaler Innovation und wissenschaftlicher Tradition – Was verstehen wir unter Hochschulbildung im 21. Jahrhundert?
01.04.19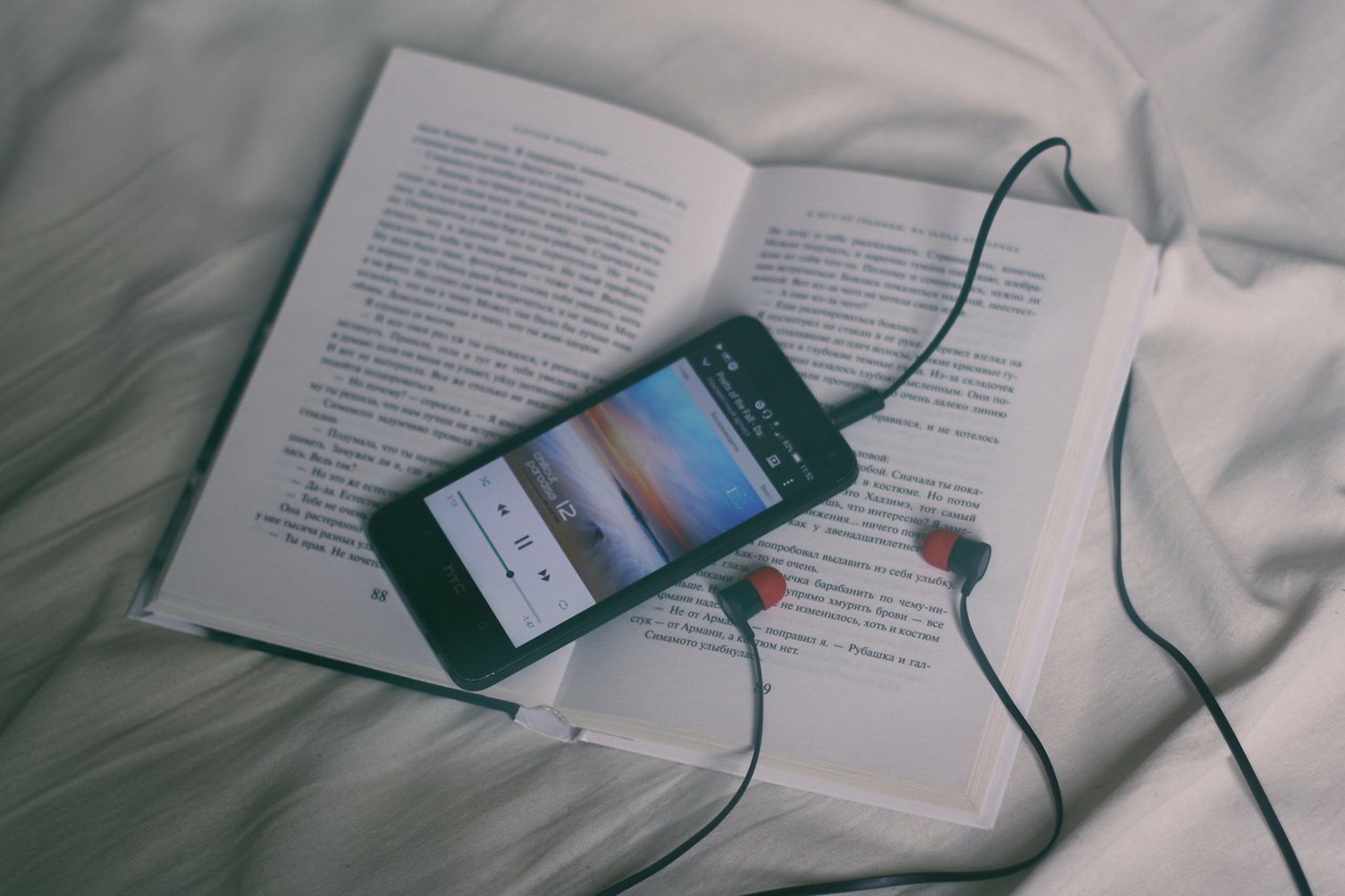
Videofeedback, Blended Learning und Remote Labs – längst hat sich der Alltag in deutschen Hörsälen verändert. Hierdurch werden auch grundsätzliche Fragen jenseits von Fächer-, Disziplin- und Ländergrenzen aufgeworfen, die im Rahmen der Ad-hoc Arbeitsgruppe „Hochschulbildung für das digitale Zeitalter in europäischem Kontext“ beleuchtet werden.
Was ist der Wert von Bildung, wenn Informationen jederzeit aus einem digitalen Wissensspeicher abgerufen werden können? Wodurch zeichnet sich Hochschulbildung aus, wenn zunehmend am konkreten wirtschaftlichen Bedarf orientierte digitale Weiterbildungsangebote auf den Markt treten? Was bleibt vom Ideal des mündigen Bürgers, wenn Wissen und seine Vermittlung, wenn Intelligenz maschinenlernbar werden soll? Diese Fragen diskutierte die Ad-hoc AG gemeinsam mit Expert*innen in einer Anhörung in Frankfurt a.M. im Frühjahr 2019. Nicht alle Expert*innen stimmten einer Videoaufzeichnung in diesem Rahmen zu, trotzdem konnten wir am Rande des Treffens einige Statements einfangen.
Prof. Dr. Stefan Bauberger: „Frage des Menschenbildes stellt sich neu“
Vor dem Hintergrund der Entwicklung künstlicher Intelligenz betonte Prof. Dr. Bauberger von der Hochschule für Philosophie München, dass die Auseinandersetzung mit menschlicher, ethischer und gesellschaftlicher Verantwortung auch im hochschulischen Raum von Bedeutung sei; ebenso wie sich die Frage des Menschenbildes insgesamt neu stelle und unser Verständnis von Bildung beeinflusse.
Prof. Dr. Alexander Filipović: „Technischen Wandel hat es immer gegeben“
Neu sei dabei nicht das Phänomen, dass technologische Neuerungen zu einem Diskurs über das Selbstbild des Menschen führten, sondern vielmehr der zeitliche und nicht zuletzt ökonomische Druck, unter dem dies geschehe, gab Prof. Alexander Filipović, ebenfalls von der Hochschule für Philosophie München, zu bedenken. Bei diesem Prozess alle mitzunehmen stelle dabei eine große Herausforderung dar, für die Gesellschaft als Ganzes ebenso wie für Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt die Wissenschaft.
Prof. Dr. Rüdiger Weis: „Zielloses Forschen ist wichtig“
Die Wissenschaft profitiere einerseits von der Digitalisierung, erklärte Prof. Rüdiger Weis von der Beuth-Hochschule für Technik Berlin. So nähmen etwa die Möglichkeiten zur Wissensspeicherung zu, bei gleichzeitig sinkenden Kosten. Daneben könne die Kommunikation und Zusammenarbeit von Forschenden durch digitale Hilfsmittel unterstützt werden, so dass es leichter werde, Wissen zu teilen oder zu schaffen. Andererseits würden althergebrachte – und durchaus erfolgreiche – Herangehensweisen wie etwa zielloses Forschen und die Befähigung zu selbstständigem Denken aufgrund ihres hohen Zeitbedarfs zunehmend infrage gestellt.
Prof. Dr. Michael Goedicke: „Man muss seine Werkzeuge kennen“
Auch Prof. Dr. Michael Goedicke von der Universität Duisburg-Essen und Vizepräsident der Gesellschaft für Informatik ging auf Veränderungen bei der Vermittlung von Bildung ein. Durch den Einsatz digitaler Werkzeuge gehe der direkte Kontakt in der Lehre in seiner Unmittelbarkeit verloren, denn zwischen Lehrenden und Lernenden trete ein Medium in Form von Informationstechnologie. Damit seien Kommunikationsprozesse gewissermaßen von außen beeinflusst, sodass Metawissen über digitale Hilfsmittel notwendig werde.
Dr. Rob Farrow: „We risk a decline in the amount of critical thinking“
Dr. Rob Farrow vom Institute of Educational Technology (UK) führte aus, das Ziel von (Hochschul-)bildung läge in diesem Zusammenhang weniger in der Vermittlung fachspezifischer Inhalte als vielmehr in der Vermittlung von Wissen darüber, wie in einer technologisch mediatisierten Welt zu navigieren sei. Es gelte, ein Bewusstsein zu schaffen für die vielen Möglichkeiten der Einflussnahme über digitale Werkzeuge, „to provide a strong enough basis for critical thinking and critical reflection.“


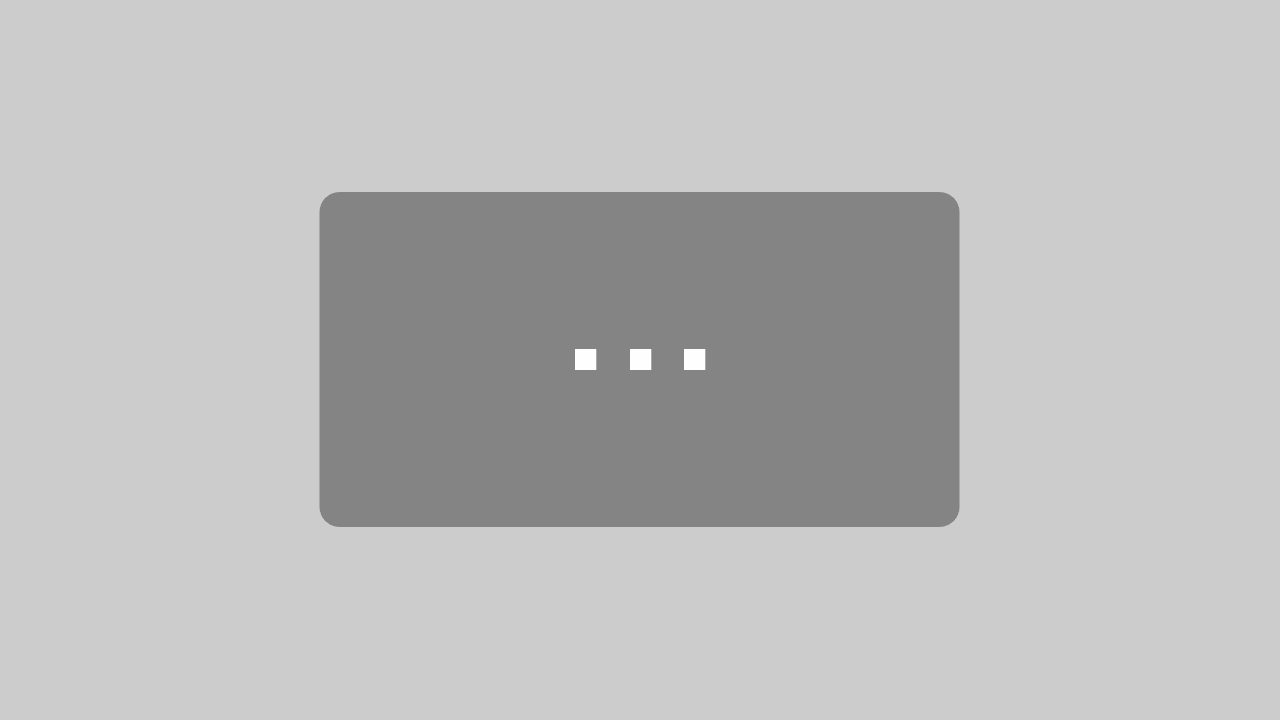
 Channa van der Brug
Channa van der Brug 