MY LEARNING JOURNEY PART 2 – EDUCATIONAL EXPERTS 2019 IN BERLIN
MY LEARNING JOURNEY PART 2 – EDUCATIONAL EXPERTS 2019 IN BERLIN
20.12.19
Für den zweiten Teil unserer Lernreise trafen wir (17 deutsche und acht amerikanische Hochschulleiter*innen) uns vom 8. bis 13. Dezember 2019 in Berlin, um weitere fünf Tage mit Gesprächen, Besichtigungen und Diskussionen zu verbringen. Lesen Sie hier den ersten Teil der EdExperts-Bildungsreise, der uns Anfang Oktober in die USA führte.

Dieser Text wurde aus dem Englischen via DeepL übersetzt und durch uns redigiert. Für etwaige Übersetzungsfehler bitten wir um Entschuldigung. Den Originaltext auf Englisch finden Sie hier.
Da einige von uns am Wochenende vor dem Seminar in Berlin ankamen, begannen wir mit einer gemeinsamen Besichtigung. Und fröhlich mischten sich Weihnachtseinkäufe und Berlin Sightseeing, Kulturaustausch mit Digitalisierungsdiskussionen, Zukunft mit Silent Disco und Regen mit Glühwein.
Sonntag, 8. Dezember
Beim Abendessen begannen wir damit über unsere Erfahrungen seit der USA-Reise im Oktober zu berichten und erste Erfolgsgeschichten zu teilen – einige von uns haben bereits begonnen erste Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt, z.B. ist ein Podcast entstanden!
Montag, 9. Dezember

Am Impact Hub wurden wir von Fulbright Deutschland und dem Stifterverband offiziell zu Teil 2 unseres EdExpert-Reise begrüßt. Dr. Gordon Bölling von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gab uns eine kurze Einführung in das deutsche Hochschulsystem, die Rolle der HRK und einige aktuelle politische Themen. Ich konnte meinen etwas anderen Standpunkt zu einigen der angesprochenen Themen nicht ganz verbergen – Studierende als Herausforderung? Wirklich?!
Anschließend sprachen Oliver Janoschka (HFD) und Alexander Knoth (DAAD) über „Internationale Hochschulmobilität und Zusammenarbeit in Zeiten des digitalen Wandels“. Es war natürlich ein bisschen wie Predigen für die Bekehrten.
Den Rest des Tages verbrachten wir auf der Konferenz „Strategies Beyond Borders„. Meine erste Session war „Driving Innovation Together: Edubadges for Microcredentialing“ mit Janina van Hees von SURF. Dies ist eine niederländische Initiative für einen landesweiten Ansatz für Abzeichen in der Hochschulbildung. Die Idee ist, dass diese Nachweise dann leicht zwischen Institutionen übertragbar sind. Im aktuellen Pilotversuch arbeiten 17 Hochschulen gemeinsam daran – beeindruckend! Ich werde diese Entwicklung auf jeden Fall weiterverfolgen.

Was mich in beiden Sitzungen beeindruckt hat, war die klare Perspektive der Student*innen: Sowohl die Edubadges als auch die Flexibilisierungsbemühungen entsprechen eher den Anforderungen der Student*innen als denen der Lehrer*innen.
Meine wichtigsten Erkenntnisse des Tages:
Sowohl in den USA als auch in den Niederlanden wurde die Bedeutung der Sichtweise der Student*innen auf das Lehren und Lernen zumindest auf institutioneller Ebene anerkannt. Und in beiden Fällen ist dies auch eine treibende Kraft für die Digitalisierung. In Deutschland noch nicht so sehr.
Nächster Halt für uns war der Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz (um unsere eigene kulturelle Bildung so gut wie möglich voranzutrieben).
Zurück auf der Konferenz haben wir uns die Zusammenfassung von Teil 1 unserer Lernreise angesehen:
Dienstag, 10. Dezember
Wir haben den Tag an der Freien Universität Berlin begonnen. Ich habe die Einführung leider verpasst (dank moderner Technologie konnte ich virtuell an der – erfolgreichen! – Wahl meiner Vizepräsident*innen teilnehmen), war aber pünktlich zu den Weltcafé-Diskussionen über institutionelle Strategien und Change Management da. Mehr über den Innovation Hub der MSU zu erfahren, hat mich nachhaltig beeindruckt. Der Innovation Hub ist eine Art interne Designberatung für Lernen, Lehren und Technologie:
Der Innovation Hub ermöglicht es Studierenden und Lehrenden, zusammen zu arbeiten und zu denken. Das Leitprinzip für die Arbeit dort lautet: Wenn wir immer die gleichen Leute einbeziehen, die auf die gleiche Art und Weise und an den gleichen Orten arbeiten, werden wir immer die gleichen Ergebnisse erzielen. Für neue Antworten (d.h. Innovation) benötigen wir also:
- Neue Leute
- Neuer Raum
- Neue Prozesse
Besonders interessant war auch zu hören, wie sie mit Design-Sprints – in der Regel von 3 Stunden, 3 Tagen oder 3 Wochen – arbeiten. Das ist ein ganz anderes Tempo als bei normalen Universitätsprozessen!
Was ich hier gelernt habe, hat unsere Erkenntnisse aus dem USA-Teil der Reise sehr stark miteinander verbunden:
- Verzögerungslösungen – Verwenden Sie Entwurfsmethoden, um den Lösungsraum zu öffnen
- Raum ist wichtig
- Sprache ist wichtig
- Führung ist wichtig

Es war mitunter auch sehr männlich dominiert.
Ich denke, wir müssen den Einstellungsprozess komplett ändern (siehe oben: Neuer Prozess!). Frauen werden immer noch mit einem starken Fokus auf Kooperation und Zusammenarbeit ausgebildet. Wenn wir erkennen, dass Zusammenarbeit der Weg in die digitalisierte Zukunft ist, erscheint es nur logisch, sicherzustellen, dass Frauen in erheblicher Zahl beteiligt sind. Vielleicht ist der Nachweis einer hohen Forschungs- und Publikationsmenge nicht das Maß, das wir in Zukunft brauchen? Vor allem, wenn wir innovative, interdisziplinäre Forschungszentren einrichten. Hier ist eine Idee: Entwerfen wir einen Einstellungsprozess für die Fakultät der Zukunft.
Das nächste Weltcafé befasste sich mit der Forschung im digitalen Zeitalter. Meine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Sitzung sind (passend zum Thema Forschung, es sind oft noch Fragen…):
- Die Forschungsmethoden ändern sich (wir waren uns nicht einig, ob diese Änderung grundlegend werden …).
- Von einem deduktiven Ansatz (Posenhypothese -> Beweise finden) zu einem explorativeren Ansatz („Sehen wir uns all‘ diese Daten an und schauen, was sie uns sagen.“)
- Werden sich auch Forschungsfragen ändern?
- Informatiker*innen und andere Wissenschaftler*innen müssen in der Lage sein, miteinander zu sprechen – deshalb braucht jede*r digitale Kenntnisse.
- Es gibt einen Unterschied zwischen der Verwendung digitaler Werkzeuge für die Forschung und der Erforschung von Algorithmen zur Beantwortung von Fragen anderer Disziplinen.
Mittwoch, 11. Dezember
 Es war kalt und der Tag begann holprig: Im Bundeskanzleramt mussten wir ersteinmal warten. Lange warten. Anscheinend wurde die Teilnehmer*innenliste im falschen Format an den Sicherheitsdienst gesendet, sodass sie nicht verarbeitet werden konnte. Anstatt EXCEL wurde ein PDF eingereicht. Offensichtlich hat es lange gedauert, die Daten manuell aus der PDF-Datei in die Tabelle zu übertragen. Das sagt viel über den Stand der Digitalisierung in der deutschen Verwaltung aus.
Es war kalt und der Tag begann holprig: Im Bundeskanzleramt mussten wir ersteinmal warten. Lange warten. Anscheinend wurde die Teilnehmer*innenliste im falschen Format an den Sicherheitsdienst gesendet, sodass sie nicht verarbeitet werden konnte. Anstatt EXCEL wurde ein PDF eingereicht. Offensichtlich hat es lange gedauert, die Daten manuell aus der PDF-Datei in die Tabelle zu übertragen. Das sagt viel über den Stand der Digitalisierung in der deutschen Verwaltung aus.
Schließlich durften wir eintreten und Kirsten Rulf, Leiterin der Abteilung Allgemeine Fragen der digitalen Politik, sprach mit uns über die Rolle ihrer Abteilung. Dies führte zu einer kurzen Einführung in die Finanzierung und Steuerung der Hochschulbildung in Deutschland, insbesondere hinsichtlich der Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundesregierung gegenüber den 16 Landesregierungen. Zum Glück hatten wir in unserer Gruppe Vertreter*innen sowohl des Bundesministeriums für Forschung und Bildung als auch eines Landesministeriums (links und rechts von Kirsten Rulf im Bild unten).
Meine Erkenntnis aus dieser Sitzung war wieder eine Frage:
- Ist es an der Zeit, mit der Strategie aufzuhören und Dinge zu tun?
Am Nachmittag gingen wir ins Betahaus zum Mittagessen und dann zu einer „Unkonferenz“. Zu uns gesellten sich einige Student*innen sowie Vertreter*innen von ED-Tech-Unternehmen. Die erste Sitzung, an der ich teilnahm, wurde von einem Studenten der #Digitalchangemakers geleitet und er erörterte, wie Student*innen in den Lehrplan oder in die Lehrentwicklung einbezogen werden könnten. Wir hatten eine interessante Diskussion und nach einigen provokanten Fragen der EdExperts, zogen wir folgende Schlüsse:
Damit die Student*innen einen Beitrag leisten können, benötigen sie:
- Informationen, die nach ihren Bedürfnissen (und nicht nach einer Lösung) fragen und sie müssen im Entscheidungsprozess gehört werden.
- Es ist wichtig, unterschiedliche Student*innen als Referent*innen zu haben, was nicht einfach zu gewährleisten ist (z. B. ist es weniger wahrscheinlich, dass diejenigen, die bereits Probleme mit ihrem Studium haben, sich auf etwas Besonderes einlassen).
- Einige Möglichkeiten, um Student*innen einzubeziehen: Einjährige Partnerschaften für ein bestimmtes Thema. Das Nutzen von digitalen Fußabdrücken der Student*innen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Und die Einführung eines „Student*innenbeirats“ (und bezahlen Sie die Studenten für ihre Zeit).
Die zweite Sitzung habe ich zusammen mit Dr. Ahmad Ezzedine von der Wayne State University veranstaltet. Wir diskutierten über unsere Idee eines virtuellen Austauschs als internationale Lernerfahrung, bei der die Student*innen kein ganzes Semester im Ausland verbringen müssen.
In der Diskussion haben wir einige Erfolgsfaktoren identifiziert:
- Führen Sie Fakultätsplanungen zusammen, so dass sich Beziehungen untereinander aufbauen
- Schaffen Sie Anreize für Lehrer*innen
- Die Student*innen sehen den Vorteil aber fragen sich auch „Wie werden Sie dafür sorgen, dass meine Zeit gut genutzt wird?“: Dies erfordert eine starke Führung durch die Lehrer*innen und es muss auch Spaß machen! Ein bisschen Urlaubsfeeling in der Zeit im Ausland darf nicht fehlen.
Meine wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Diskussionen:
- Die Zukunft ist ungewiss, daher ist es ratsam, verschiedene Ansätze auszuprobieren.
- Wir müssen weniger Angst vor dem Scheitern haben!
Donnererstag, 13. Dezember
An der Humboldt-Universität haben wir am Vormittag unsere Erkenntnisse aus dem zweiteiligen Seminar zusammengeführt und Perspektiven für zukünftige Kooperationen erarbeitet.
Dies sind einige der Ergebnisse zum Thema Digitalisierung:
- Bei der Digitalisierung geht es um den Menschen.
- Online-Lernen wird unterschätzt (zumindest in Deutschland) – es wird hingegen in den USA sehr effektiv als Marketinginstrument genutzt.
- Wir brauchen „Data Bildung“, die über die Datenkompetenz hinausgeht.
Wichtige Erkenntnisse zur Transformation:
- Verwenden Sie Entwurfsmethoden: Raum ist wichtig & Sprache ist wichtig
- Design statt Entwicklung
- Experimente statt Trial & Error: Haben Sie den Mut, Dinge zu stoppen, die nicht funktionieren – aber geben Sie die Dinge nicht zu früh auf. Es setzt Energie für Innovationen frei.
- Hören Sie auf zu planen – fangen sie an zu Dinge zu tun
Und über den Unterschied zwischen den US-amerikanischen und deutschen Hochschulen: In den USA bewegt man sich als Individuum, während man in Deutschland als Block agiert. Das macht den Wandel in Deutschland viel langsamer.
Am Ende dieses zweiten Teils unseres EdExperts-Seminars waren wir erschöpft und aufgeregt. Es war eine fantastische Erfahrung mit erstaunlichen Menschen an erstaunlichen Orten zu spannenden Themen zusammenzukommen. Vielen Dank an die Fulbright Stiftung, das Hochschulforum Digitalisierung und Impact Hub!


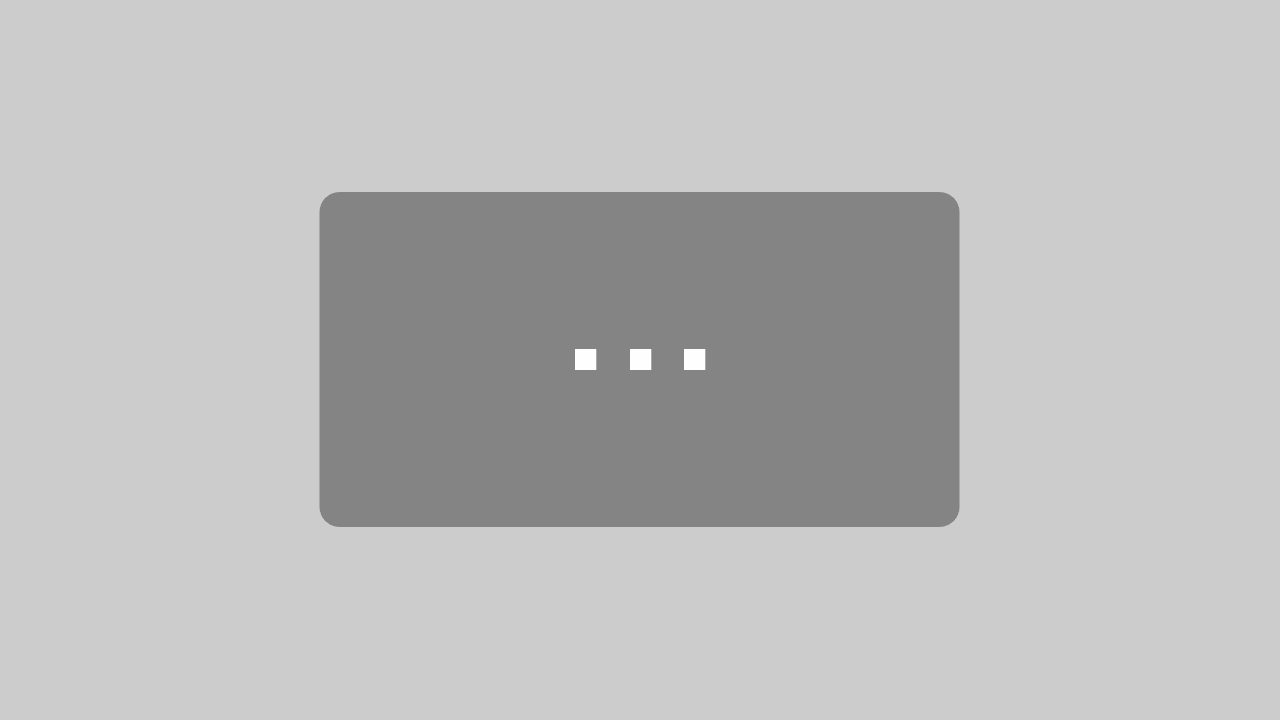

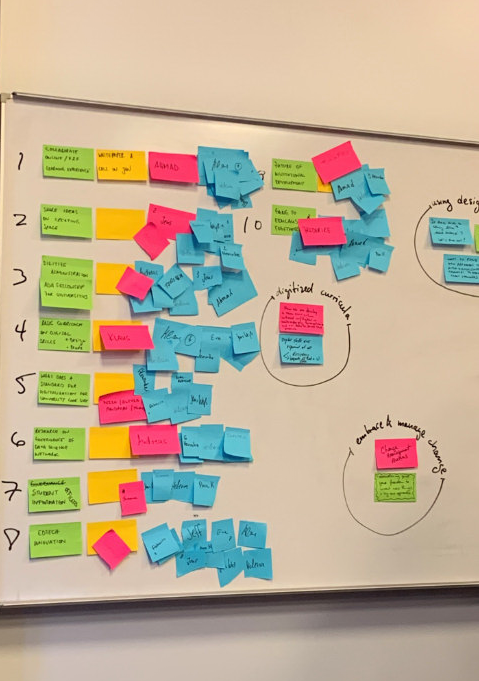
 Channa van der Brug
Channa van der Brug 