Es ist Wahlkampf und niemand denkt Bildung groß genug
Es ist Wahlkampf und niemand denkt Bildung groß genug
20.09.21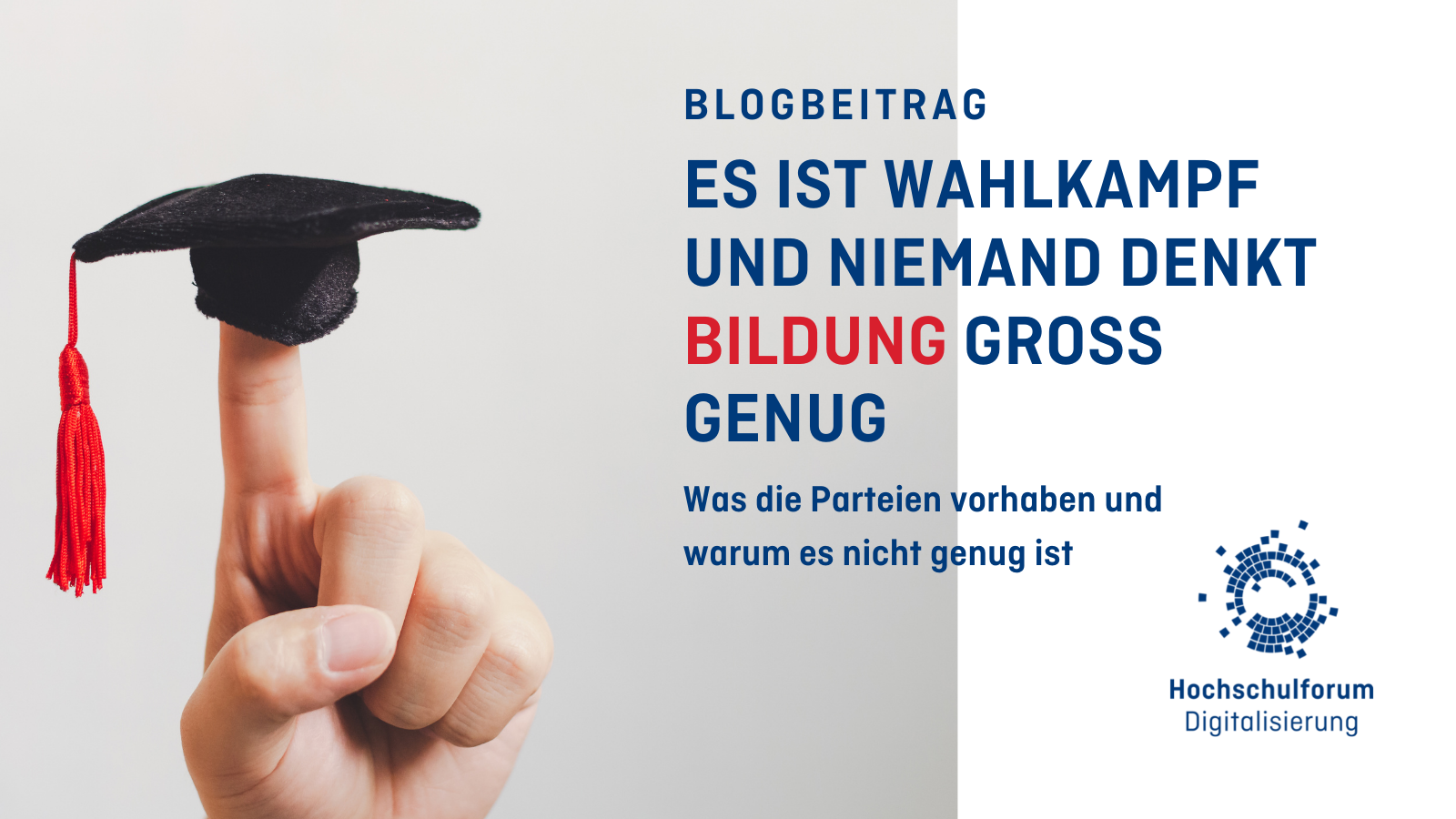
Wahlkampf ist traditionell geprägt von Kontroversen: Jede Partei möchte sich selbst ins beste Licht rücken und die Konkurrenz in den Schatten stellen. Um Bildung geht es dabei in diesem Jahr viel zu selten. Dabei brauchen wir dringend eine radikale Transformation des Bildungssystems. Was die einzelnen Parteien für die Bildung vorhaben und warum das nicht weit genug geht.
Vor uns liegen große Herausforderungen: der Kampf gegen die Klimakrise, den wachsenden Populismus, das Ringen um adäquate Formen der Digitalisierung. Um sie zu meistern, müssen wir unser Bildungssystem radikal transformieren. Lebensbegleitendes Lernen ist ein Schlüsselfaktor, um diesen Wandel zu bewältigen. Doch hat das die Politik verstanden? Bislang spielt Bildung im Wahlkampf allenfalls eine Nebenrolle. Dabei ist eine parteipolitische Aufwertung lange überfällig. Das Bildungsressort verdient es, im gleichen Atemzug mit Finanz- und Wirtschaftsministerium genannt zu werden! Parteiübergreifend herrscht eine schon fast irritierende Einigkeit in vielen Bildungsfragen: Die meisten Parteien bekennen sich etwa in ihren Programmen zum Lebenslangen Lernen, möchten die digitale Bildung fördern, Bildungszugänge verbessern, die berufliche Bildung aufwerten und neue Governance-Strukturen schaffen.
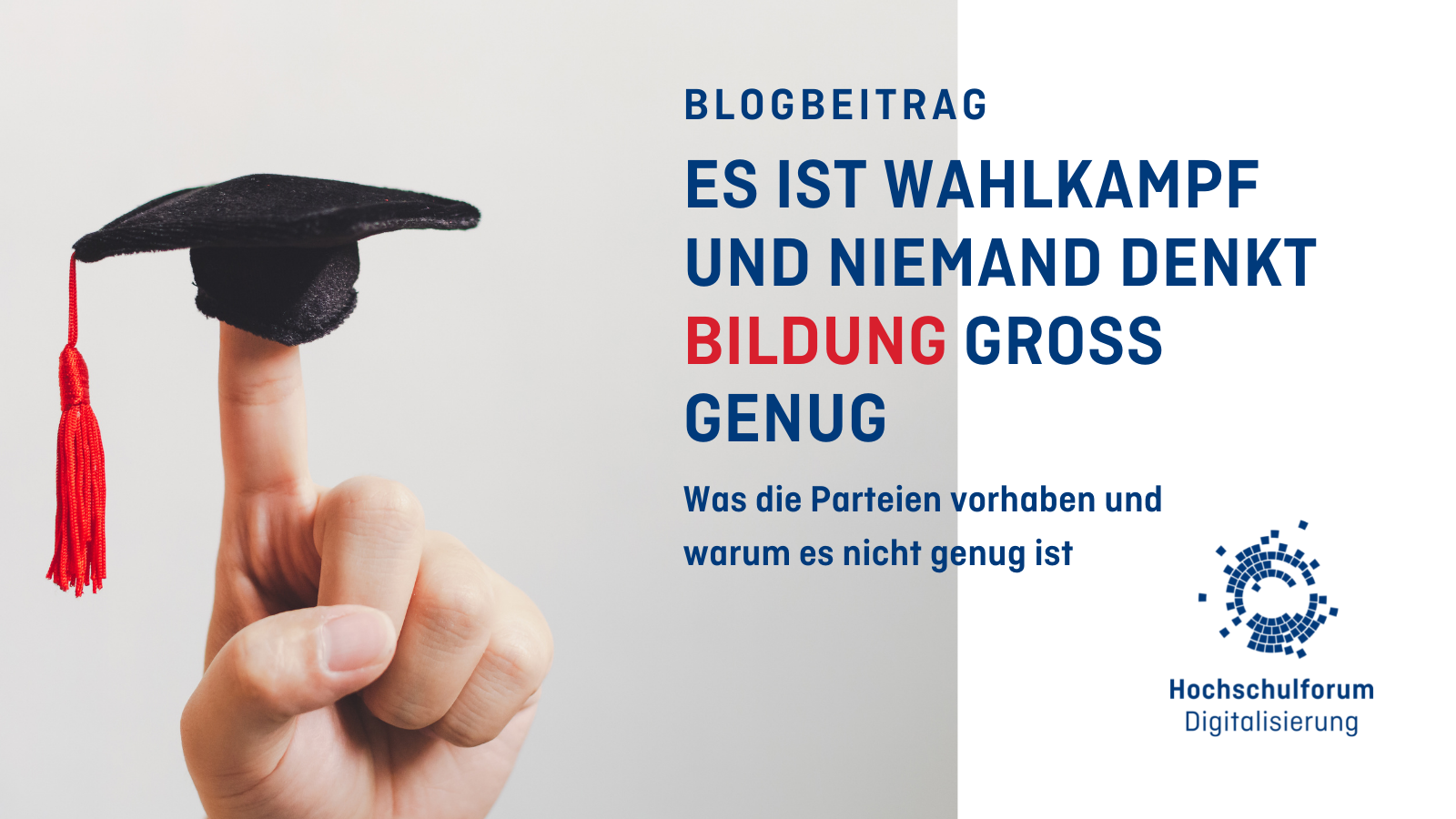
Wo sich die Parteien unterscheiden
Wer genauer hinsieht, erkennt natürlich dennoch verschiedene Schwerpunkte. Was planen die Parteien für die Bildung, wo liegen ihre Prioritäten? Darüber habe ich für den New-Learning-Podcast mit führenden Bildungspolitiker:innen des Deutschen Bundestages gesprochen, die sich fundiert mit wesentlichen Aspekten des Lebensbegleitenden Lernens auseinandergesetzt haben.
- Die Grünen möchten eine Weiterbildungskultur fördern, die einen klimagerechten Wohlstand sichert, und unter anderem ein Weiterbildungsbafög einführen.
- Die SPD plant einen Sozialtarif für das Internet, um Schüler:innen und Studierenden den Zugang zu digitaler Bildung zu erleichtern. Außerdem soll Qualifizierung weniger an wirtschaftliche Verwertbarkeit gebunden sein.
- Die CDU/CSU möchte vor allem begonnene innovative Maßnahmen aus der vergangenen Legislaturperiode fortsetzen und nachbessern.
- Die FDP stellt sich vor, dass Menschen zu Piloten ihres eigenen Lebenslaufs werden, und möchte ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben errichten.
- DIE LINKE setzt den Schwerpunkt auf Bildungsgerechtigkeit: Insbesondere sozial Benachteiligte sollen stärker gefördert werden.
Unzufriedenheit mit dem Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern zieht sich durch alle Parteien – einige (Grüne, SPD, Linke) wollen die Regel zugunsten einer stärkeren Zusammenarbeit komplett kippen, die CDU/CSU möchte es zumindest modifizieren, wenn auch nur moderat.
Keine Frage – viele dieser Vorschläge können das Bildungssystem verbessern. Richtig gut machen können sie es nicht. Meiner Auffassung nach wird die Radikalität, mit der wir den Bildungsbereich transformieren müssen, von der Politik massiv unterschätzt. Nicht abgerufene Milliarden an Fördergeldern führen uns seit Jahren drastisch vor Augen, dass wir grundsätzlich an der Governance des Bildungssystems arbeiten müssen. Das ist eine Herkulesaufgabe, allerdings für den Erfolg unvermeidbar. Standards wie das Abitur und Infrastrukturen wie digitale Lernplattformen sollten nicht in jedem Bundesland neu erfunden werden, sondern einfach zu nutzen, vergleichbar und eben standardisiert sein. Beim Schienennetz wollen wir auch nicht, dass jedes Land andere Spurweiten hat.
Die einzelnen Einrichtungen brauchen weitgehende Autonomie (das ist im Hochschulbereich besser gelöst als etwa im Schulbereich). Und wir müssten Fragmentierung, Versäulung der Bildungssektoren sowie hohe rechtliche Regulierung durch Flexibilisierung, Entrümpelung und kräftige bzw. ungewöhnliche sektorübergreifende Vernetzungen vorantreiben.
Was Hochschulen für die Zukunft des Lernens brauchen
Viele Elemente der Governance des Hochschulbereiches wären auch für die anderen Bildungssektoren zukunftsträchtig. Dennoch hat die Corona-Pandemie offenbart, was digital ambitionierte Lehrende seit Jahrzehnten anmahnen: Viele Hochschulen sind digital nicht gut auf eine virtuelle Lebensrealität eingestellt. Dabei geht es zum einen um die technische Ausstattung und die Etablierung entsprechender Unterstützungsstrukturen. Der HRK-Präsident fordert daher zu Recht eine von Bund und Ländern bereitgestellte Digitalisierungspauschale pro Student/in für Infrastruktur und Weiterqualifizierung. Es braucht zum anderen auch die großflächige Auseinandersetzung mit innovativen didaktischen Konzepten. Anstatt analoge Inhalte digital „zu übersetzen“, müssen wir größer denken: eine neue Lernkultur entwickeln und bereit sein, den Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt aktiv mitzugestalten. Kollaborative und vernetzte Lernformen müssen dabei alltäglich und strukturell gut unterstützt werden. Wir müssen konsequent von den Lernenden aus denken. Damit das gelingt, brauchen wir mehr Know-how bei den Lehrenden, Kooperation, Erfahrungsaustausch und Beispiele guter Praxis. Jede politische Förderung sollte diese Ziele in den Blick nehmen. Insofern war die Weiterförderung des Hochschulforums Digitalisierung ein politisch wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dann bräuchte es noch weitere, sehr kräftige nationale (und europäische) Vernetzungsanstrengungen der Hochschulen, damit digitale Souveränität nicht nur ein Schlagwort bleibt. Hier bringt die FernUniversität auch gerne weiterhin ihre Erfahrungen mit orts- und zeitunabhängigen Studienmodellen und Lernern ein, deren Lernbiografien bereits fest im 21. Jahrhundert verankert sind.
Hier finden Sie alle Beiträge der Blogserie zur Bundestagswahl 2021:
Teil I: Analyse: Allgemeine Themen rund um die Hochschulpolitik
Teil II: Analyse: Digitalisierung der Bildung und Netzausbau
Teil IV: Meinungsbeitrag: Digitalisierung der Bildung von Julius Friedrich, Projektleiter HFD beim CHE Centrum für Hochschulentwicklung
Teil V: Gastbeitrag von Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität in Hagen


 Channa van der Brug
Channa van der Brug 